Di
23
Mai
2023
Kriegsdienstverweigerung russischer Soldaten und Wehrpflichtiger als Asylgrund anerkennen
Es wird hierzulande viel darüber diskutiert ob man russischen Kriegsdienstverweigerern das Recht auf politisches Asyl zusprechen dürfe.
Dagegen wird vor allem juristisch argumentiert. So konnte man schon hören, dass Desertion, also die Flucht von der Truppe, vor Kriegsdienst und Wehrdienst, ja auch in Deutschland strafbewehrt sei.
Zum zweiten spielt hier Groll gegenüber der russischen Gesellschaft im Allgemeinen, und ihrem männlichen Teil im Besonderen eine Rolle, der unterstellt wird, sich viel zu leicht und unbedenklich vor den expansionistischen Karren des Putin’schen Russland spannen zu lassen, und erst jetzt, wo es der russischen Armee an den Kragen geht, aus Angst vor den persönlichen Konsequenzen, also dem eigenen Tod, ihr Heil in der Flucht vor dem Armeeeinsatz zu suchen und es sich selbst mittels des Asylrechts in Deutschland wohl sein zu lassen. Dieser Groll aber ist blind für die Komplexität auch der Situation der russischen Gesellschaft. Er macht die Opfer der Putin’schen Repressionspolitik im eigenen Land zu ihren Tätern. Er ruft mehr nach Rache als nach Schwächung der russischen Armee.
Es mag sein, dass erst der Krieg Russlands gegen die Ukraine aus Kriegsdienstverweigerern politische Widerständler gemacht hat. In der Sache läuft es auf das gleiche hinaus. Wer sich in Russland einem Einsatzbefehl für den Krieg gegen die Ukraine widersetzt, muss mit politischer Verfolgung und schweren Strafen rechnen. Und deshalb sollte er bei uns als politisch Verfolgter anerkannt werden.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist eindeutig ein Völkerrechtsbruch, also Unrecht. Daran ändert die innere Rechtslage Russlands Null. Wir haben es in Russland mit dem schlimmsten Unrecht zu tun, nämlich jenem, das im Gewande des Rechts daherkommt.
Auch Soldaten haben Rechte. Sie sind aus menschenrechtlichen aber auch aus Gründen des Völkerrechts nicht verpflichtet, Befehle, die eine Verletzung des Völkerrechts verlangen, auszuführen. Sie dürfen sie verweigern. Der ganze Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Bruch des internationalen Völkerrechts. Die militärischen Angriffe gegen die ukrainische Zivilbevölkerung kommen dabei noch erschwerend hinzu.
Wer sich also durch seine Kriegsdienstverweigerung in Russland versucht diesem Unrecht zu entziehen, sollte sich auf die internationale Praxis des Menschenrechts berufen dürfen. Weil er dafür vom russischen Staat verfolgt wird, handelt es sich ganz eindeutig um eine politische Verfolgung. Und damit greift unser deutsches Asylrecht.
Und außerdem gibt es da noch einige wesentliche politische Zusammenhänge. Deutschland hat angesichts russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eindeutig Stellung bezogen hat. Es hat erklärt, dass Russland der Aggressor ist, dass Russland damit Völkerrecht bricht. Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Es wird ihr helfen sich der russischen Invasion zu erwehren, solange dies nötig ist und von der Ukraine gewünscht wird.
Es macht doch überhaupt keinen Sinn russischen Kriegsdienstverweigerern, die durch ihre Kriegsdienstverweigerung das russische Militär schwächt für eine Handlung zu bestrafen, die in unseren Augen unterstützenswert ist.
Das grundsätzliche Einräumen von politischem Asyl gegenüber den russischen Kriegsdienstverweigerern stärkt jenen Männern in Russland den Rücken, denen angesichts des Unrechtscharakters des russischen Krieges gegen die Ukraine deutlich wird, dass hier eine Grenze überschritten wird, dass sie hier nicht mehr mitmachen dürfen, dass sie eine persönliche Entscheidung treffen müssen; eine Entscheidung, die politischen Widerstand darstellt.
Und nicht zuletzt wäre ist das grundsätzliche Einräumen von politischen Asyl für russische Kriegsdienstverweigerer ein ganz klares Signal an die sich entwickelnde russische Zivilgesellschaft, dass wir uns mit ihr solidarisieren und ihr Bemühen um einen demokratischen und rechtsstaatlichen Wandel in Russland begrüßen und unterstützen.
Ergo kann in Bezug auf die russischen Kriegsdienstverweigerer in und von Deutschland nur erklärt werden, dass diese Kriegsdienstverweigerung von uns begrüßt, unterstützt wird, und dass die Verfolgung von russischen Kriegsdienstverweigerern in Russland, selbst da, wo sie nur angedroht ist, bei uns als politischer Asylgrund gewertet wird.
Fr
28
Apr
2023
Zirkelschlüsse – oder der Primat des Macht- und Wahrheitsanspruchs der SED

Bei der Lektüre von Rosenbergs „Die beschädigte Kindheit – Das Krippensystem der DDR und seine Folgen“, dessen Besprechung ich hier veröffentliche, ist mir die Geschichte einer bemerkenswerten Ärztin und Hygienikerin besonders aufgefallen, deren Schicksal stellvertretend für eine ganze soziale Gruppe der DDR steht:
Eva Schmidt - Kolmer, 1913 in Wien geboren, war eine Medizinerin, gleichzeitig Kommunistin und jüdischer Herkunft. Sie ist in Österreich aufgewachsen, hat sich dort politisch links
orientiert (in der Sozialdemokratie und im kommunistischen Jugendverband), studierte Medizin, und musste schließlich vor den Nazis fliehen. Nach der Rückkehr aus ihrer Emigration ging sie 1946
nach Ostberlin, wo ihre Approbation anerkannt wurde, die sie in Österreich nicht mehr erhalten hatte.
In der DDR war sie bis zum Schluss leitende Hygienikerin und über Jahrzehnte eine führende Expertin in Sachen Krippensystem und Wochenkrippe. Sie starb 91 in Berlin.
In ihren wissenschaftlichen Studien stellte sie fest, dass das Krippensystem der DDR die hier untergebrachten Kinder traumatisierte, weil der Verlust der Mutter durch nichts zu kompensieren war.
Eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit und eklatante Entwicklungsrückstände bei den Kindern waren die Folge. Diese Auseinandersetzungen um das Für und Wider des Krippensystems prägten die 50er
Jahre.
Die SED sah das nicht gerne, aber das zuständige Gesundheitsministerium bewilligte Eva Schmidt-Kolmers einschlägige Studien immer wieder. Dennoch hielt die SED an ihrer Linie eines forcierten
Ausbaus der Krippensystems trotz der bekannten Studienergebnisse, die die Nachteile der Krippen unter Beweis stellten, aus ideologischen, pädagogischen und politischen Gründen fest. Sie standen
im eklatanten Gegensatz zu diesen Studienergebnissen. Schmidt-Kolmer hat dagegen nicht protestiert. Im Gegenteil, sie hat sich und ihre Studienergebnisse sogar selbst verleugnet. Als im Neuen
Deutschland, dem Zentralorgan der SED eine Diskussion um die Qualität der Krippen geführt wurde, war offenbar auch Eva Schmidt-Kolmer gehalten, als offenkundige Expertin und wissenschaftliche
Autorität daran teilzunehmen. Und jetzt verteidigte sie das Krippensystem gegen den Vorwurf, dass die Kinder dort Schaden nähmen, und eine Herausreißen aus der Familie schädlich sei. Und sie
verteidigte sie mit den gleichen Propaganda-Argumenten, mit der die SED immer die Forcierung des Krippensystems begründet hat.
Danach und davor aber hat sie die Studien betrieben, die klar begründeten, dass und warum die Krippen schädlich für die kleinen Kinder waren.
Als Hilde Benjamin dann Anfang der 60er Jahre als Justizministerin beim Gesundheitsminister gegen diese Studien von Schmidt-Kolmer intervenierte, wurden sie nicht mehr betrieben.
Schmidt-Kolmer hat das hingenommen und nie protestiert. Später hat sie dann sogar die Einbeziehung der Krippen in das Bildungsziel der "entwickelten sozialistischen Persönlichkeit" konzeptionell
begleitet. Sie war bis ans Ende der DDR die Expertin auf dem Gebiet der Krippenerziehung in der DDR.
Also, was ist da passiert:
Ich denke, dass für Frau Schmidt-Kolmer Parteiräson vor ihrer eigenen Wissenschaft rangierte. Das heißt, die Unterordnung unter den Macht- und Wahrheitsanspruch der SED war ihr wichtiger als das
Festhalten an ihren Studienergebnissen. Gerade in der Zeit, als sie die Studien betrieb, muss ihr klar gewesen sein, dass die Linie der Partei ganze Generationen von Kindern schädigt. Trotzdem
hat sie die Linie der Partei verteidigt. Warum macht man das? Ich denke, weil ihr ihr metaphysischer Glaube an die historische Mission der Arbeiterklasse unter Führung der Partei der
Arbeiterklasse wichtiger war und grundlegender als die Ergebnisse ihrer Studie. Ich denke, dass sie Kritik an ihrer eigenen Partei nicht artikulieren konnte, weil sie davon überzeugt war, dass es
wichtiger ist, den Macht- und Wahrheitsanspruch der SED zu unterstützen, als diesen mit wissenschaftlichen Studien in Zweifel zu ziehen. Die Richtigkeit des Marxismus-Leninismus, sein
historischer Materialismus, der Glauben an den Sozialismus, an das Weltprojekt Sozialismus/Kommunismus, als das war in ihren Augen ein höheres Gut, als ihre wissenschaftlichen Studien, die sie
mit ihrem eigenen Verhalten entwertet hat. Sie glaubte an ihren Kommunismus, obwohl dieser Glaube ihre Arbeit, ihre Integrität und ihre wissenschaftliche Autorität entwertete.
Offenbar war sie zu einer Reflektion dieses Widerspruchs, den sie persönlich auszutragen hatte, nicht in der Lage. Sie konnte ihren eigenen Glauben an die SED nicht hinterfragen. Denn das hätte
bedeutet, ihr ganzes Leben in Zweifel zu ziehen. Das kam für sie nicht in Frage. Sie verbot sich offenbar das Nachdenken über die Gründe dieses Widerspruchs zwischen ihrer wissenschaftlichen
Arbeit, die sie hochklassig durchführte, und dem Machtanspruch ihrer Partei.
Und wenn man sich das mal klar macht, was das eigentlich heißt, einen Macht- und Wahrheitsanspruch zu akzeptieren, dann wird einem klar, dass die SED die Macht hatte, bei ihren Anhängern zu
definieren was richtig und was falsch ist. Das heißt die Propaganda musste geglaubt werden, und sie wurde geglaubt. Wenn die Partei etwas sagte, dann galt das, unabhängig davon, dass man
persönlich wusste, dass die Partei die Unwahrheit sagte.
Dieser Glaube gab der Partei die Macht, das was sie für wahr hielt, in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Machtanspruch hieß also, bestimmte Ansichten als geltende öffentliche Wahrheiten zu
definieren und die Leute zu zwingen, sich ihnen unterzuordnen. Das taten auch gebildete Menschen, Intellektuelle. Menschen mit Sachverstand, mit Geist, mit Bewusstsein. Es war ihr Glaube an den
Sozialismus, der sie zu diesem Verhalten führte.
Wer einmal diesen Glauben angenommen hatte, war in einem geschlossenen Weltbild gefangen, aus dem er offenbar aus eigener Kraft nicht mehr herauskam. Der gab sein Gewissen, sein
wissenschaftliches Ethos, seine Fähigkeit zu eigener Urteilskraft an der Pforte zum Eintritt in die Partei ab.
Umgekehrt hätte das Nachdenken über die Hintergründe dieses offenkundigen Widerspruchs zwischem eigenem Wissen und Erfahrung und dem Macht- und Wahrheitsanspruch der SED zu einer Auflösung des
Glaubens an den Macht- und Wahrheitsanspruch geführt, und damit den Glauben an den Kommunismus, und den historischen Materialismus aufgelöst. Dann hätte der Einzelne entdecken können, welchen
Strukturen er sein Gewissen und sein Ethos opferte.
Ja, der Begriff des Opfers der eigenen Urteilskraft scheint mir hier angemessen zu sein. Und mit dem Opfer der eigenen Urteilskraft opferte man auch seine Individualität, seine Persönlichkeit.
Man ging im Kollektiv der Glaubenden auf. Damit erlosch auch die Fähigkeit zur Verantwortung für das, was man als richtig erkannt hatte.
Denn wer im Kleinen entdeckt, das heißt bei sich selbst, wie sehr der Macht- und Wahrheitsanspruch die eigene Urteilskraft beschädigt, und in Frage stellt, und wer also letztlich seine eigene
Urteilskraft ausschaltet, der weiß dann auch, dass das ein Allgemeinphänomen der ganzen Gesellschaft ist. Und der kann sich ausrechnen, zu welchen Folgen das führt, nämlich zu einer Schädigung
der Gesellschaft, und damit auch zur Niederlage - der eigenen Partei, ja zu einer Niederlage letztlich sogar des Glaubens an den Sozialismus. Das heißt, dieser Widerspruch ist die Widerlegung des
Glaubens an die Partei und an den historischen Materialismus.
Dieses Problem hatte nicht nur die Eva Schmidt-Kolmer, das hatten alle Intellektuellen, die an der DDR und der SED wegen ihres Sozialismus festhielten.
Man kann das als ein metaphysisches, als ein ideologisches, als ein religiöses, aber letztlich vor allem als ein geistiges Problem erkennen, mit dem das Problem des Niedergangs der DDR
unmittelbar verbunden war.
Das ist die Antwort auf die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, warum sich in der SED keine politischen Kraft fand, die sich dem greisen Politbüro unter Honecker in den Weg gestellt
hat.
Ihnen fehlte die geistige Kraft, das Problem des Niedergangs der DDR zu durchdringen, weil sie nicht bereit waren, die Prämissen ihres Glaubens an ihren Sozialismus in Frage zu stellen. Sie waren
in einer Falle ihres Denkens, ihres Glaubens gefangen. Weil sie an ihren Sozialismus glaubten, konnten sie sich nicht vorstellen, dass er auf einem Irrtum beruhte, nämlich dem Macht- und
Wahrheitsanspruch. Weil sie, wenn sie darüber nachdachten, also über ihren Lebenswiderspruch nachdachten, an die Grenzen des Macht- und Wahrheitsanspruch stießen, den in Frage zu stellen
sie sich nicht trauten, konnten sie die Falle, in der sie sich befanden nicht erkennen, nicht sehen, nicht auflösen.
Und das perfide an dem Macht- und Wahrheitsanspruch ist zudem noch gewesen, dass er von jedem, der Macht hatte, angewandt werden konnte. Jeder Minister, nicht nur Honecker, konnte in seinem
Bereich anordnen, was als Wahrheit zu gelten hatte. Jeder Funktionär. Jeder Leiter. Und dieses System, wo jeder seinen Machtanspruch in seinem Herrschaftsanspruch durchsetzen konnte,
funktionierte nur, wenn er den Machtanspruch des jeweils hierarchie-Höheren nicht in Frage stellte.
Das erklärt übrigens auch, weshalb Honecker den Schürer hat abtreten lassen, als der ihn auf die ruinöse Finanzpolitik des Staates hinwies. Honecker verfügte über den Machtanspruch persönlich,
als Generalsekretär. Und er wendete ihn immer da an, wo er sonst nicht weiter wusste. Dass er seinen Laden damit immer weiter in den Abgrund ritt, interessierte ihn weniger. Mit Logik kam Schürer
da nicht ran. Der Macht- und Wahrheitsanspruch gab jedem, der über ihn verfügte die Macht, zu definieren, was richtig und falsch ist. Ein Diskurs aber ist nur da möglich, wo es keinen
Macht- und Wahrheitsanspruch gibt. Folglich kann man sich nur korrigieren, wenn man seinen Macht- und Wahrheitsanspruch aufgibt.
Und wer mit einem Macht- und Wahrheitsanspruch regiert, der muss zwangsläufig zur Gewalt greifen, um ihn durchzusetzen. Nur da, wo der Machthaber über Gewalt verfügt, kann er seinen Macht- und
Wahrheitsanspruch durchsetzen. Und weil das letztlich Terror bedeutet, widersprachen die betroffenen Opfer nicht, denn sie hatten Angst vor dieser Gewalt.
Aus dem Wahrheitsanspruch folgt der Machtanspruch, und aus dem Machtanspruch folgt die Fähigkeit zu definieren, was Wahrheit ist. Und aus diesem Wahrheitsanspruch folgt wieder der Machtanspruch.
Eine unendliche Reihenfolge an Macht- und Wahrheitsansprüchen, ein perfides totalitäres Spiel.
Traurig und dramatisch, was daraus folgte. Ganze Generationen an Intellektuellen im Kommunismus haben da geistig ins Gras gebissen, und nicht wenige auch physisch.
Letztlich hat sich historisch und philosophisch der dialektische Materialismus selbst widerlegt. Aber eine ungeheure Zahl an Opfern hat er erzeugt, ganz zu schweigen von den
Kollateralschäden.
Dass ein solches Denksystem nicht überleben kann, liegt auf der Hand. Doch wer hat das gesehen in der DDR.
Und zum Schluss muss man feststellen, ist das Problem des Macht- und Wahrheitsanspruches auch mit dem Ende der DDR nicht untergegangen. Er ist Alltag in der unserer politischen, in der medialen Welt, in Wissenschaft und Kultur. Er ist bei cancel culture genauso zu beobachten, wie bei der AfD oder der militanten Öko-Bewegung. Nur dass in unserer offenen Gesellschaft Gewalt nur sehr begrenzt oder subtil eingesetzt werden kann.
Im in den Gründungspapieren der SDP (Sozialdemokratische Partei in der DDR) hatte Martin Gutzeit den Satz untergebracht: „In tiefer Ablehnung jeglichen totalitären Denkens und Handelns, gründen wir eine sozialdemokratische Partei.“. Der ist aktueller, denn je.
Di
18
Apr
2023
Mein Freund-Partner Martin Miehe
Gestern ist mein Freund und Klavierspielpartner Dr. Martin Miehe 75 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlaß hat mich seine Tochter um einen Beitrag für eine Art Festschrift zu diesem Geburtstag, der im kleinsten Kreise begangen wurde gebeten.
11.4.2023

Über Martin, bzw. meine Geschichte(n) mit ihm zu schreiben, heißt für mich immer auch, meine eigene zu erzählen. Martin sah ich nie von ferne, immer von nah, zumindest seit wir gemeinsam Klavier spielen; und das haben wir eigentlich immer getan. Die Gelegenheiten, wo uns nicht das Klavier zusammenführte, kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Und doch hat es sie gegeben, und sie waren nicht das Schlechteste was mir mit ihm und durch ihn passiert ist.
Mein Verbindung zu ihm begann auf einer Treppe, dem Eingang zur Geschwulstklinik der Berliner Charité, wo ich ihm quasi zufällig begegnet bin. Ich wusste, dass er in der Charité arbeitet. Ich wusste von ihm, aber ich suchte ihn nicht. Warum sollte ich? Ich hatte als Teenie mal in seinem Bett in Darlingerode geschlafen, in dem schönen Pfarrhaus von Pfarrer Miehe, mit dem mein Vater befreundet war. Mein Vater schätzte ihn sehr, und ich glaube, diese Wertschätzung beruhte auf Gegenseitigkeit. So viel Freunde hatte mein Vater nicht. Aber über seinen Kollegen und Amtsbruder Miehe hat er sich immer gefreut. Er hat gut von ihm gesprochen, und er hat jede Gelegenheit genutzt, Pfarrer Miehe zu seinen Jugendlichen, seiner Jungen Gemeinde in der Berliner Tieckstraße, Gemeindehaus von Golgatha einzuladen.
Vater Miehe beherrschte die Relativitätstheorie aus dem ff. Und er verstand es, diese schwierige Materie in einer so anschaulichen und fesselnden Art seinen Zuhörern mitzuteilen, dass die nicht von seinen Lippen wichen. Ich habe das selbst erlebt, und auch ich war gebannt von seiner Art, Weltraumphysik zu erklären. Der Kontakt beschränkte sich bei den beiden Amtsbrüdern nicht auf gegenseitige Vorträge, wir besuchten auch das Ehepaar Miehe in Darlingerode selbst. Und natürlich war da auch die Rede von Martin, dem Mediziner-Sohn, und wenn Frau Miehe von ihm sprach, schwang da immer auch Bewunderung und Stolz mit. Weniger beim Vater, der hielt sich mit Bewunderung zurück. Als Vater und Mann machte man sowas einfach nicht. Das kannte ich von meinem Vater auch. Und trotzdem bewunderte auch Vater Miehe seinen Sohn. Das konnte man spüren, wenn der z.B. über dessen Zensuren und Leistungen in Schule und Studium sprach.
Und so war eigentlich meine Beziehung zu Martin von Anfang an eingebettet in die Beziehung unserer Eltern, besser unserer Väter zueinander. Vielleicht haben sie an ihren Grundlagen mitgearbeitet, gestiftet aber haben sie die Freundschaft nicht.
Gleichwohl ist unsere Freundschaft auch ein Teil unserer jeweiligen Familiengeschichte. Und die spielt bei uns beiden immer schon eine große Rolle.
Trotzdem, bis zu jenem Moment auf der Treppe der Geschwulstklinik gab es für mich keinerlei Anlass, Kontakt zu Martin aufzunehmen.
Nun aber hatte mich mein damaliger Klavierlehrer, Prof. Dietrich Brauer auf ihn angesprochen. Das war nicht sehr rühmlich für mich, fand ich zumindest, und es entsprach überhaupt nicht den Zielen, die ich mit dem Klavier für mich verbunden hatte.
Brauer war ein Nonkonformist. Er hob sich ab von der Mehrzahl seiner Kollegen, ihrem Dünkel, ihrem Ehrgeiz und ihrem Wohlgefallen an ihrer sozialen Stellung. Das war Brauer alles ziemlich egal. Er liebte moderne Klaviermusik, mit der eigentlich kein Staat zu machen war. Aber hier war er ein Spezialist, und in der DDR eine kleine Berühmtheit. Und er war bereit Schüler zu unterrichten, an denen sich seine Kollegen die Finger ausgebissen hatten. Es interessierte ihn nicht, ob sie sich wohlverhielten, fleißig übten, und überhaupt brav an ihrer Laufbahn arbeitete. Ihn interessierten Persönlichkeiten, wohl auch Begabungen, wenn sie noch verschüttet waren. Er konnte stundenlang Geschichten über Musiker- oder Künstlerbiografien erzählen. Wenn er an etwas glaubte, dann an das Potential, das in einem steckte.
Und ich, der ich erst spät begann, mich für eine Musikerkarriere, gar eine Pianistenkarriere zu erwärmen – eigentlich habe ich mich ja erst nach meiner Armeezeit richtig dafür entschieden – war für die meisten Klavierlehrer viel zu alt, als dass sie mir zugetraut hätten, die hohen Gipfel der Klavierkunst zu ersteigen. Er war wohl damals der einzige Hochschullehrer, der überhaupt bereit war, sich auf jemandem wie mich einzulassen. Leider gelang es mir trotz seiner Bemühungen nicht, die Aufnahmeprüfungen an Hans-Eisler zu bestehen. Zweimal unterzog ich mich dieser Tortur, das zweite Mal hat mich Brauer schon gar nicht mehr begleitet. Er war nicht der Meinung, dass ich das Klavierspielen nicht erlernen könnte, aber er befürchtete, dass das ziemlich lange dauern würde, und dass ich mir keine Vorstellungen von den Mühen machen würde, die mir bevorstehen würden. In seiner Jugend will man von solchen Sorgen nichts wissen, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich schlug Brauers vorsichtigen Einwände in den Wind, überzeugt davon, dass Wille und Energie wichtiger sind als Erfahrung und Geduld. Zuerst übergab mich Brauer seinem Meisterschüler, Pantscho Vladigeroff, der ihn aber in pädagogischer Hinsicht enttäuschte. Und dann unterrichtete Brauer mich persönlich. Gemessen am Ziel einer Aufnahme in die Hochschule für Musik, erfolglos, gemessen an Lebenserfahrung, spannenden Gesprächen, Einführung in die Welt der Kunst des Klavierspiels, von bleibendem Wert.
Brauer war, obgleich Mitglied der Ost-CDU beileibe kein Parteigänger des SED-Regimes, sich wohl auch bewusst, dass die Hürden, die ich für ein Klavierstudium zu überwinden hätte, nicht nur pianistischer Natur waren. Und da begann er, mich vorsichtig auf eine Alternative zum Studium einzustellen. Das klang in etwa so: Er hätte da neulich einen Arzt, einen entfernten Verwandten – erst kürzlich entdeckt – kennengelernt, der wäre ein fantastischer Blattspieler, der spielt alles vom Blatt, was man ihm hinstellt, ganz gleich unter welchen Umständen, und vor welchem Publikum. Und man muss nicht Pianist sein, um Klavier zu spielen. Und ich könnte ja mal Kontakt zu ihm aufnehmen.
Ich wollte nicht.
Ich war Programmierer zur damaligen Zeit. Meine Arbeitsstelle war das Institut für medizinische Physik und Biophysik, ein vorklinisches Institut der Charité. Die Rechner, die ich zu programmieren hatte, befanden sich im ersten Stock der Geschwulstklinik. Da ging ich jeden Tag ein und aus. Programmieren machte mir Spaß, aber es war nicht mein Lebensziel, es füllte mich nicht aus. Es war mir schlicht zu wenig, ohne Perspektive, ohne Ruhm, ohne Ehrgeiz. Das heißt, ich programmierte eigentlich nebenher. Man brauchte zwar Zeit dafür, aber eine Herausforderung war das nicht.
Klavier war eine Herausforderung, schwer zu erlernen, aber mit Perspektive und mit Seele, wenn ich das hier so nennen darf. Meine Computer hatten ja viel, eine Seele hatten sie nicht. Sie füllten mich nicht aus, auch wenn ich mir im Institut durchaus Anerkennung erworben hatte. Doch das zählt nicht, wenn der Sinn nach anderem steht.
Und dann stehe ich eines Tages auf der Treppe zur Geschwulstklinik und Martin kommt mir entgegen. Der Zufall selbst hat das entschieden. Und dann sprach ich ihn an. Zumindest ist das meine Erinnerung. Martin mag eine andere haben. Ist egal. Wie wir uns verabredeten, weiß ich nicht mehr. Aber wir taten es, und wir trafen uns in seiner Wohnung, Waldeyer Str. 9, Nähe Bahnhof Frankfurter Allee.
Martin hatte eine Wohnung, da quollen einem die Augen über, fast so schön wie die von Brauer. Im riesigen Erkerzimmer über der Häuserecke standen zwei Flügel gegenüber, ein Traum für jemanden wie mich. Und was noch schöner war, man konnte zu jeder Tages- und Nachtzeit dort spielen.
Ich war zur Vorbereitung vorher in der Musikbibliothek der Berliner Stadtbibliothek gewesen, und hatte einen Schatz entdeckt, die Kunst der Fuge von Bach in einer Fassung von 1936 für Klavier zu vier Händen.
Die nahm ich mit zu Martin, und sie gehörte zu den ersten Stücken, die wir beide vollständig spielten.
Ich konnte vorher noch nicht Blattspielen. Martin nahm mir die Sorgen davor. Er brummelte irgendwas von: das kriegst Du schon. Heute würde ich sagen, Blattspielen kann man lernen. Aber man lernt es nicht wie schreiben oder lesen. Blattspielen kann man nicht langsam anfangen, beim Blattspielen muss man sofort ohne Umschweife sofort mit dem richtigen Tempo beginnen, man muss so viel Noten wie möglich, so schnell es geht erfassen und sofort auf die Tasten bringen. Das ist Höchstleistung fürs Gehirn. So was lernt man nicht mit kognitiver Leichtigkeit. Das lernt man nur durchs Tun. Ich lernte es bei der Kunst der Fuge.
Wir spielten eine Fuge nach der anderen. Die Kunst der Fuge hat etwas mehr als 20 davon. Unterschiedlich lang, keine unter 5 Minuten. 3-stimmig, vier-stimmig, fünf-stimmig, Doppelfugen, Quadrupelfugen, Kanons, schnell, langsam, alles dabei. Und ich weiß nicht mehr wie; die Zeit verging wie im Fluge. Die Familie von Martin, zwei kleine Kinder, Traudel, alles schlief schon, es war weit nach Mitternacht, da spielten wir beide die Kunst der Fuge immer noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schön geklungen hat. Ich habe meine Hände nur noch auf die Tasten gelegt, irgendwie spielten die von allein. Aha, dachte ich, so lernt man also Blattspielen. Und als wir fertig waren, war es weit nach Mitternacht, etwa halb zwei, und es klingelte an der Tür. Gott sei Dank war ich nicht der Hausherr. Mutig, couragiert und entschlossen, männlich halt, wie der ganze Martin, schritt er zur Tür und öffnete. Da war keiner. Aber einer Rose lag auf der Schwelle. Das war unsere erste Anerkennung, die wir erhielten, zumindest interpretierten wir das so. Vielleicht war es auch ein diplomatisch gefasster Hinweis, dass es jetzt langsam reicht. Wer weiß das schon. Der Urheber, oder die Urheberin dieser Rose hat sich nie zu erkennen gegeben. Wir aber hatten unsere erste schöne Geschichte miteinander.
Martin und ich trafen uns jetzt öfter.
Wir spielten Schubert, von Anfang an spielten wir Schubert. Das war sowieso einer meiner auch unserer Lieblingskomponisten, manchmal nach, manchmal vor Bach. Und wir hatten das Glück am Anfang gleich die f-Moll-Fantasie zu spielen. Die fängt sehr leise an. Das gehörte nicht gerade zu unseren Vorzügen. Ich übte wie ein Berserker. Und wir kämpften miteinander und gegeneinander um die leisen Töne, und die schönen Melodien.
Man mag einwenden, Musik sei doch eine Sache der Schönheit und des Gefühls, da müsse man doch nicht kämpfen. Diejenigen, die das sagen, haben nichts verstanden. Gar nichts.
Ich kann nicht sagen, dass ich immer glücklich war über unser Spiel. Und Blattspielen war ja noch eine zusätzliche Herausforderung. Aber gelegentlich bekam unser Spiel Spirit. Das war bei den ersten vier Kontrapunkten der Kunst der Fuge der Fall, das war bei der f-Moll-Fantasie von Schubert so, das war bei Debussys Petite Suite so. Und offenbar kam diese Musik auch an.
Das wollte wir auch zeigen. Und so begann die Serie der Hauskonzerte im Hause Miehe, Waldeyer Str. 9, in den 80er Jahren in Ostberlin. Und Martin wäre nicht Martin, wenn da nicht die creme de la creme zu Gast gewesen wären. Bärbel Bohley mit ihrem Mann Dille, Rathenow, der Cembalist Thalheim, Anne Quasdorf, von den vielen Medizinern ganz zu schweigen. Und natürlich nicht zu vergessen, Pastor Cyrus, und Gemeindepfarrer von Galiläa und nebenbei Vikariatsvater von Thomas Krüger, um die Ecke, der Hauspastor von Martin, und ihm freundschaftlich verbunden.
Diese Hauskonzerte waren immer schön. Es gab Musik. Man war aufgeregt. Wir spielten. Traudel spielte, meine Schwester spielte, wir spielten gemeinsam, wir spielten jeder allein. Wir konnten gar nicht aufhören. Und wenn es ans Ende ging, sagte ich zu Martin, lass uns noch eins spielen. Und dann spielten wir noch eins. Und wenn es denn nach Mitternacht war, meinte Martin, er würde mich nach Hause fahren, oder zu U-Bahn. Aber dann spielten wir noch eins. Und Martin und ich tranken noch eins. Und dann konnte Martin nicht mehr Auto fahren. Tat er aber manchmal doch. Und ich war ihm dankbar dafür.
Und nun kam ich auch manchmal auf seine Station in der Hautklinik, da war er nämlich Stationsarzt. Meine Güte, hatte das einen Klang: Stationsarzt. Unsereins war ja nicht krank, Mitte 20 ist man kaum mal ernsthaft krank. Aber man brauchte diesen Zettel. Und Martin sagte dann immer, komm mal zu mir auf die Station. Und da kriegte man diesen Zettel. Martin war da schon immer recht freigiebig. Natürlich, wenn man wirklich was hatte, gab es eigentlich keinen besseren Arzt als ihn. Und das ist bis heute so geblieben. Auch wenn ich heute keinen Zettel mehr brauche.
Die Erfahrungen auf der Station von Martin waren in jeder Hinsicht lehrreich. Martin ging in seinem weißen Kittel über den Flur, von Zimmer zu Zimmer. Und manchmal schlichen sich Patienten von der Seite ran, und steckten ihm eine Tafel Schokolade in die tiefe Kitteltasche. Martin tat, als würde er nichts merken, und die Leute schlichen sich wieder. Dankbarkeit ist eine merkwürdige Kategorie.
Martin hatte da Fähigkeiten, über die sprach er manchmal. Zum Beispiel Anamnese. Die Leute erzählen ja viel. Ich kannte ja Martin inzwischen, der machte nicht viel Worte, und wer ihn nicht kennt, konnte das für Aufmerksamkeit halten. Ich frug ihn einmal, wie er denn die Zeit so verbringt, wenn die Patienten ihm ihr ganzes Leben erzählen. Ja, meinte er. Manchmal erzählen die viel. Und er will sie auch nicht unterbrechen. Denn das kann ja wichtig sein, dass die mal erzählen können, auch wenn das überhaupt nichts mit der Krankheit zu tun hat. So wie ich Martin kenne, hat er sich gelangweilt. Und so frug ich ihn, was er denn dann mache, wenn ihm die Leute so viel erzählen. Er guckte mich an, und meinte dann, er memoriere dann Gedichte. Eine typische win-win-Situation.
In der Hochphase unseres Zusammenspiels waren wir fast jede Woche mindestens einmal zum Klavierspielen in der Waldeyer Straße. Inzwischen lebte ich mit Beate zusammen, die war häufig mit dabei. Traudel war ja nicht immer zu Hause, die spielte ja im Babelsberger Filmorchester und hatte abends zu arbeiten. Dann übte Beate mit Verena oder Daniel irgendwelche Sportübungen, oder machte Hausaufgaben mit ihnen und solche Sachen, und Martin und ich konnten spielen.
Doch wir spielten nicht immer. Es gab Sachen, da spielte Martin nicht. Das war zum Beispiel, wenn die Zahnspange von Daniel verschwunden war. Ich hatte ja den Verdacht, dass das kein Zufall war. Dann suchten wir die Zahnspange. Und Martin fand sie immer, er hat bis heute eine Engelsgeduld beim Suchen. Und er findet immer, was er sucht.
Martin war der erste Patenonkel, den wir für unser erstes Kind Johanna ausgesucht hatten. Als Beate und ich ihn frugen, freute er sich, und er weiß bis heute, wann Johanna Geburtstag hat. Ich glaube, er hat sie einmal angerufen. Das ist schön. Und Johanna hat immer jemanden, wo sie hingehen kann, wenn sie mal krank ist. Wir sind damals viel mit Johanna in der Waldeyer Straße gewesen. Denn erstens war es da schön, und man konnte musizieren, und zweitens war unsere eigene Wohnung in der Kriemhildstrasse das glatte Gegenteil von der Waldeyer Straße, klein, niedrig, eng, die ganze Wohnung ein Symbol für die Wohnungsmisere in der damaligen DDR.
Damals war es, dass Martin meine Ehe rettete. Ich bin ausgerissen – oder wie soll ich das nennen - von zu Hause, von der Kriemhildstrasse im Bewusstsein, dass ich das nicht mehr aushalte, und wegwill, und dass ich dafür auch meine Familie, Frau und Kind verlasse. Und natürlich bin ich zuerst, völlig orientierungslos zu Martin in die Waldeyer Straße gefahren. Da war er noch gar nicht da. Traudel war da. Und die sah mich an, ein Häufchen Unglück, das ich damals wohl war, erfasste die Situation, meinte ich solle mich mal hinsetzen, Martin käme nachher.
Dann kam er, machte nicht viel Worte, nahm mich mit, und fuhr mich zurück in die Kriemhildstrasse Das war nicht unwichtig, für mich, und für meine Familie. Aber es war kein Ergebnis langen Redens. Geredet wurde eigentlich gar nichts. Stattdessen gehandelt. Ich hatte gedacht, dass ich es nicht mehr aushalte, in der Kriemhildstrasse. Aber plötzlich war ich wieder da.
Ja, das Leben hat seine Krisen, damals wie heute. Und manchmal ist es einfach gut, wenn es jemanden gibt, der einen einfach zurückfährt. Und der nicht viel redet, sondern handelt. Wenn es denn immer so einfach ist?
Das Leben ging weiter.
Inzwischen hatte ich nach meiner zweiten verkrachten Aufnahmeprüfung meine pianistischen Ambitionen für beendet erklärt und mich für ein Fernstudium zum Ingenieur für Informationsverarbeitung entschieden. Denn von irgendwas muss man ja leben. Und wenn ich schon mal Programmierer war, dann wollte ich wenigstens etwas mehr Geld damit verdienen.
Die DDR war auch nicht mehr das, was sie mal war. Es gab zwar kein Tauwetter in der DDR, aber Verwandtenbesuche zweiten Grades, man konnte in den Westen fahren. Davon profitierten wir beide, Martin und ich, leider nicht zusammen. Und einmal hatte ich das große Glück, und konnte, gesponsert von einem Westonkel in die Toskana nach Florenz, der Stadt der Renaissance reisen. Und wieder einmal begriff ich, welches Verbrechen die SED an uns, an der Bevölkerung der DDR verübte, indem sie ihr die offene, große Welt draußen vor der Mauer von Berlin vorenthielt, im Falle von Florenz auch das Studium ihrer geistigen und ästhetischen Wurzeln. Ich schreibe das hier, weil das Folgen für meine Freundschaft mit Martin hatte.
Denn so voll, wie ich aus Italien 1987 zurückkam, voller Eindrücke, und Massen an Fotos, so gab ich die weiter unmittelbar nach meiner Rückkehr aus dem Westen, mit einem durchschlagenden Erfolg, der mir damals gar nicht so bewusst war. Erst Jahre später erzählte mir Martin, dass es meine Reiseerzählungen und Reflektionen waren, welche in ihm das bereits ins Auge gefasste Vorhaben einen Ausreiseantrag zu stellen, nicht mehr weiter aufzuschieben, sondern bekräftigen und realisieren ließen.
Doch für mich brach – angesichts des Ausreiseantrages – eine Welt zusammen.
Das war das Schicksal des DDR-Bürgers. Es wurden immer weniger. Es gingen so viele in den Westen, Freunde, Bekannte, Kollegen, wertvolle Menschen, Menschen, die fehlten. Man vereinsamte, und man war sauer. Es haute mich um, als Martin mir davon erzählte. Ich konnte es ja verstehen. Die Probleme der Kinder in der Schule, die persönlichen Einschränkungen im Beruf, die täglichen Diskriminierungen im Alltag der DDR…..
Aber weg ist weg. Und wenn ein Freund in den Westen ging, dann war er eben auch weg. Es ging ein Stück von einem selbst dabei verloren. Alltag für einen DDR-Bürger. Ich hätte das auch machen können. Aber noch wollte ich nicht. Ich wollte mein Land nicht den Kommunisten überlassen.
Damals versuchte ich meinen Kummer in Musik umzusetzen. Und das gelang auch. Wie auch immer, am Ende beherrschte ich die 24. Fuge h-Moll von Bach aus dem Wohltemperierten Klavier Nummer 1. Ein kompliziertes, hochschwieriges Stück, voller Tücken und langen musikalischen Bögen, dessen Schönheit mir immer bewusst war, aber an das ich mich nie herangewagt hätte. Wenn ich denn nicht etwas zu verarbeiten gehabt hätte. Und wenn ich nicht meine Empfindungen in dieser Fuge widergespiegelt gesehen hätte. Das war wichtig.
Und außerdem hat Martin ja nichts anderes gemacht als sein gutes Recht geltend. Nicht er war schuld an der Misere des Verlassenwerdens in der DDR, sondern dieses Land. Nicht an ihm hatte ich mich abzuarbeiten, sondern an diesem Staat und das, für das der sich hielt.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein wesentlicher Grund für mich war, in die Opposition in der DDR einzutreten, aber das spielte sicher mit.
Opposition ist auch eine eigene Geschichte. Auf jeden Fall konnte man in ihr Lebensmut gewinnen.
Und beides, Opposition und meine enge Freundschaft zu Martin, muss irgendwie dem MfS aufgefallen sein. Denn als ich am 7. Oktober 89 zur Gründung der SDP aufbrach, da hat sich die Stasi auch in der Waldeyer Str. bei Martin und Traudel umgesehen, ob ich nicht vielleicht hier wäre, damit sie mich abhalten könnte an dieser Gründung teilzunehmen.
Ich bin dann abends nach der Gründung mit Beate noch bei Martin gewesen. Ich weiß nicht wie, und was wir mit unseren Kindern gemacht haben. Ich war völlig high, ohne irgendwelche Drogen genommen zu haben. Ich musste diesen Tag verarbeiten. Wir haben wohl Klavier gespielt. Wir hatten uns weit vorher verabredet, ohne auf den politischen Kalender zu kucken. Ich zumindest ahnte da noch nichts davon, dass ich am 7. Oktober der 1. Sprecher der neu gegründeten SDP werden würde.
Von nun an hatte ich nicht mehr viel Zeit fürs vierhändige Klavierspielen. Einmal kam Martin zufällig zu mir in die Wohnung, mitten in der friedlichen Revolution, und er war schon umgezogen nach Westberlin, da tagte hier gerade unser geschäftsführender Ausschuss oder so. Und was spielten wir? Bach, Kunst der Fuge, zum Ergötzen meines anderen Freundes, der, zufällig oder nicht, auch Martin heißt, Martin Gutzeit.
Martin ging eigentlich nicht in den Westen, der Westen kam zu ihm, wie zu allen von uns. Als der Umzugswagen vor Martins Tür stand, war die Mauer schon offen. Bis auf den spontanen Besuch von Martin bei mir in der Wohnung unmittelbar in der Wendezeit, haben wir uns das ganze Jahr nicht gesehen.
Und danach brauchten wir eigentlich einen neuen Anlauf. Ich hatte einen Job, der mich schwer einband. Und Martin, der sich als praktizierender Facharzt eine neue Existenz aufbaute, hatte nun auch nicht gerade viel Zeit. Das gemeinsame Musizieren fehlte mir, und es scheint mir so im Rückblick, es fehlte auch Martin.
Mit dem Ende der DDR, dem Ende des SED-Regimes hatte sich auch für unser Klavierspiel ziemlich viel geändert. Diese Hausmusiken, die wir veranstaltet hatten, waren ja ein Ersatz für den Mangel an öffentlichen Gelegenheiten, die es in der DDR für uns nicht gab, weil die SED auch über jede Form von künstlerischen Veranstaltungen wachte, weil sie alles in der Hand behalten wollte, und unterband, was ihr nicht passte. Unsere Hausmusiken waren immer ein Event, und sie waren ein kleines Abenteuer, sie hatten etwas Intimes, sie hatten einen Hauch von Freiheit an sich. Sie waren ein Beispiel für eine eigene Kultur, die ich Untergrund-Kultur oder gar Sub-Kultur nicht nennen will, das wäre wohl übertrieben, aber sie hatten ihren spezifischen Charme eben nur in der DDR entwickeln können. Das fiel jetzt weg. Auch der Gewinn von Freiheit kann Fehlstellen erzeugen.
Manchmal spielt einfach Glück die entscheidende Rolle. In meinem Fall war das Pfarrer Zahn, den ich anlässlich eines Gedenkgottesdienstes in Mühlberg (Elbe) für die Opfer des Internierungslagers unweit von dort, kennen und schätzen lernte, und der mich zu sich in seine Saxdorfer Kirche einlud, wo ich mir aussuchen durfte, welche Form von Veranstaltung ich dort durchführen wollte. Pfarrer Zahn lebte dort gemeinsam mit seinem Lebenspartner, dem Maler Hans-Peter Bethke, und beide hatten während der DDR-Zeit ein kulturelles Kleinod aus dem Ensemble von Kirche, Garten und Sommerveranstaltungen geschaffen, das im weiten Umkreis dort im Süden von Brandenburg seines Gleichen nicht hatte. Und beide haben es verstanden, diesen Charme, den sie dort entwickelt hatten aus der DDR heraus in die Zeit nach der Deutschen Einheit zu bewahren, ja weiter zu pflegen und zu entwickeln. Ihnen war der Schritt in die Öffentlichkeit gelungen.
Und natürlich entschied ich mich für ein Konzert für Klavier zu vier Händen mit Martin. Es war das erste öffentliche Konzert, das Martin und ich überhaupt gaben. Es war glaube ich Frühjahr 1993 und ich kam zu spät zum Konzert. Ich hatte meine komplette Familie im Auto, und jeder weiß, dass Termine mit Kind und Kegel schwer zu halten sind, und ich konnte nicht anrufen. Aber Martin war schon da. Wie schwer ich ihn auf die Folter gespannt hatte, bei einer vollen Kirche, mit einem Publikum, das auf die Matadoren wartet, und einer ist noch nicht da, und man weiß nicht, ob er noch kommt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Pfarrer Zahn uns zuerst mal Kuchen anbot, als wir endlich da waren. Und Kaffee, damit wir uns abregen können. Und dann war das ein extrem schönes Konzert. Es war das erste Konzert nach der Wende, und es war der Beginn einer ganz anderen Art von Musizieren, als wir in der DDR praktiziert hatten.
Ich hätte es kaum für möglich gehalten, dass wir einen solchen Erfolg haben würden. Und das machte mir und wohl auch Martin Mut, es auch mit anderen Formen zu probieren.
Und so spielten wir beispielsweise in einer gemeinsamen politischen Veranstaltung mit Jürgen Fuchs, der aus seinen Büchern las im Finsterwalder Kreismuseum 1994, die auch ein großer Erfolg wurde. Ich konnte diese Unterstützung echt gebrauchen. Sogar das Fernsehen war da, mehr Promotion kann man gar nicht haben.
Und dann kamen die Potsdamer Konzerte hinzu, die ein echtes Kontinuum für uns wurden, und die jedes Jahr in der Adventszeit den Veranstaltungssaal füllen, erst im Mendelssohn-Haus am Heiligen See, und nun seit vielen Jahren im Lichtenau-Palais gegenüber den Parkanlagen von Schloss Cecilienhof.
Wir sind mit unseren Konzerten nicht Teil des industriellen Musik-Betriebes, und das ist bestimmt auch ganz gut so. Es gibt aber darunter eine Ebene des semi-professionellen Musikbetriebes, der öffentlich stattfindet, auch vermarktet wird, und der von Musikliebhabern mit viel ehrenamtlicher Arbeit realisiert wird, und wo gelegentlich sogar Geld verdient wird. Da sind zum Beispiel die Waidmannsluster Konzerte in der Königin-Luise-Kirche, die im Wesentlichen dem Ehepaar Nieschalk zu verdanken sind. Beide haben es geschafft ein Publikum zu entwickeln, das in ausreichender Zahl dafür sorgt, dass diese Kirche mit wöchentlichen Musikveranstaltungen Menschen aus ganz Berlin anzieht, die sich hier wohlfühlen, die gerne kommen, und die auch gerne wiederkommen. Das würden sie nicht, wenn sie nicht die Erfahrung gemacht hätten, hier immer etwas Schönes und Bleibendes geboten zu bekommen. Den Kontakt zu Helga und Wolfgang Nieschalk hat Martin geknüpft. Ich muss zugeben, ich habe ihn weidlich für mich und anderweitige Konzerte in anderen Besetzungen ausgenützt. Martin möge mir verzeihen.
Ein besonderes highlight war unser Konzert im Kraftwerk Plessa, weithin sichtbar jedem, der die B169 zwischen Elsterwerda und Ruhland unterwegs ist. Ich war Schirmherr dieses Kraftwerks, das bis 1990 Braunkohle verstromt hat, und das dann zu einem Industriedenkmal umgewidmet wurde. Und ich war befreundet mit seinem Geschäftsführer Hajo Schubert, der mit seinem Temperament und Optimismus einzigartig war und ansteckend.
Als ich in diesen riesigen Hallen stand, die einst vom Maschinenlärm dröhnten, die jetzt leer waren, und die einen Klang ermöglichten, die jeder norddeutschen Hallenkirche Konkurrenz machen konnten, da war mir klar, dass wir hier einfach Klavier spielen mussten.
Hajo Schubert war in seinem Organisations-Element. Er beschaffte den Flügel, einen Konzertflügel aus dem spätstalinistischen Kulturhaus, das die SED einst der Braunkohlengemeinde Plessa zum Geschenk gemacht hatte, und das, weil es unter Denkmalschutz steht, den Ort auf ewig prägen wird. Doch den Flügel benützte dort niemand. Hajo Schubert organisierte einen Kran, der den Flügel durch ein Fenster auf den Turbinentisch des Kraftwerks bugsierte. Wir spielten direkt neben der Siemens-Turbine, die hier bis 1990 Strom ins Netz eingespeist hat.
Das wurde das größte Konzert, das wir je gegeben haben. Vierhundert Leute waren anwesend. Wir spielten von Bizet die Kinderstücke und Faure und Debussy und Bach, das ganze Programm. Martin war so aufgeregt, dass er mit dem Spielen bereits begann, da saß ich noch nicht mal richtig, und hatte zu tun, den Anschluss zu finden.
Einer unserer Höhepunkte in unserer gemeinsamen Klavier-Karriere war unser Konzert im Münchner Gasteig, organisiert und gestaltet von Eberhard Zagrosek, einem ehemaligen Manager, den ich durch Prof. Sava, bei dem ich lange Jahre Unterricht nahm, kennenlernen durfte. Zagrosek ist auch ein begnadeter Pianist, der nun nach seiner beruflichen Karriere seiner Leidenschaft frönte, und u.a. ein Festival von Amateurpianisten, den „Gasteig Meister-Marathon“ in München veranstaltete. Allen Künstlern gemeinsam war, dass sie von ihrem Klavierspiel nicht leben mussten, ihr Geld anderweitig verdienten. Aber im Gegensatz zu uns beiden hatten sie alle studiert, z.T. an renommierten Häusern, wie dem Pariser Konservatorium. Die beiden einzigen echten Amateure waren Martin und ich. Aber niemand von ihnen spielte vierhändig, oder gar an zwei Klavieren. Wir gaben das Abschlusskonzert an zwei Klavieren mit Poulenc und Reger, sauschwer und hochvirtuos. Und was den Amateurstatur betrifft, der ist nur ein label, ein Etikett und besagt gar nichts. Musik fragt nicht nach Rang und Stellung, Musik will erfasst und gestaltet werden. Das ist ihr Maß, nicht der Titel.
Und dann sollten wir eigentlich in Venedig spielen. Doch das Konzert musste abgesagt werden, weil genau in dieser Woche die Corona-Pandemie ausbrach. Beate und ich verlebten ein herrliches Wochenende im leeren Venedig. Corona haben wir erst später bekommen. Und Venedig müssen wir eigentlich noch mal angehen. Ist verlockend.
Martin wird jetzt 75. Andere haben da ihre musikalische Karriere schon lange beendet. Martin hat das nicht im Sinn. Beate und ich gratulieren von ferne aus der Hauptstadt der Musik, aus Wien.
Die nächsten Konzerte sind schon terminiert.
Es gelingt immer wieder, einen Teil des musikalischen Gehalts der vielen Stücke, die wir spielen, zu Gehör zu bringen, oder, wie man so sagt, den Funken überspringen zu lassen. Manchmal bin ich vor einem Konzert nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Manchmal bin ich ernüchtert, manchmal frustriert. Aber in einem Konzert ist das alles weg. Die Probenphasen sind manchmal quälend. Wie gesagt, Musik hat auch mit Kampf zu tun. Die Konzerte sind alle schön. Einmal haben wir Grand Duo von Schubert gespielt, das fand ich nicht so toll. Jetzt werden wir es wiederholen. Und ich verspreche, es wird ein Genuss.
Und es wäre schön, wenn es uns vergönnt bliebe, gemeinsam noch viel spielen zu dürfen.
Unser aller Leben ist endlich. Das ist unsere Natur. Doch die Fähigkeit zur Musik ist auch ein Teil unserer Natur. Und sie zu gestalten, das haben wir, im Gegensatz zur Dauer unseres Lebens in der Hand. Gebe es Gott, dass wir noch viel musizieren können.

Fr
31
Mär
2023
Schlieben-Berga braucht Unterstützung
Schlieben-Berga liegt auf einem kleinen Sandberg, wie er typisch für die Brandenburger Eiszeitlandschaft ist, etwa Luftlinie einen km von der Bundesstraße 87 zwischen Herzberg/Elster und Luckau entfernt, mitten im Wald. Vor und hinter Schlieben muss man mehrere km Auto fahren, ohne durch eine Ortschaft zu kommen. Idyllisch für die einen, schrecklich für die anderen.
Diesen Ort hatte die Reichskriegswirtschaft unter Minister und Architekten Albert Speer Anfang der 40er Jahre auserkoren, um hier, geschützt und relativ ungefährdet Panzerfäuste herstellen zu lassen. Mit dem Bau und Betrieb der Produktionsanlagen wurde die Hugo Schneider AG (HASAG) einem Leipziger Metallbauunternehmen, das seine Produktion schon im 1. Weltkrieg auf Munitionsfertigung umgestellt hatte, beauftragt. Es hatte mit der Herstellung von Panzerfäusten expandieren und sich eine führende Stellung in der deutschen Rüstungsindustrie erarbeiten können.
Arbeitskräfte gab es ja nicht. Das machte weder der HASAG noch der SS etwas aus, dafür hatten sie ja die KZ-Häftlinge, in diesem Fall aus Buchwald, die nach Schlieben-Berga überführt wurden. Das Stammlager richtete in Schlieben eines seiner vielen Außenlager ein. Fortan gab es unzählige Transporte nach und von Schlieben. Denn ausgehalten haben es die KZ-Häftlinge in Schlieben nicht lange. Die Produktion der Panzerfäuste war so giftig, dass die Lebenserwartung nicht selten nur wenige Wochen betrug. Viele der KZ-Häftlinge starben in Schlieben, die Kranken und Schwachen hingegen, die zur Produktion nicht mehr zu gebrauchen waren, wurde zurückgebracht nach Buchenwald, wo sie nicht mehr lange zu leben hatten.
Nur deshalb ist der Friedhof, der in Schlieben umgekommenen Häftlinge nicht so groß. Und die meisten Gräber stammen von den Opfern einer Explosion in der Gießerei, von der man nicht weiß, ob es sich dabei um Sabotage oder einen Unfall gehandelt hat.
Schlieben-Berga ist ein Friedhof, jüdische Opfer liegen hier neben Sinti und Roma, neben politischen Häftlingen, Frauen und Männer, alte und Junge, aus vielen Teilen Europas kommend. Selten hat Schlieben eine solche Internationalität erlebt, wie zu Zeiten der Rüstungsproduktion.
Die Schliebener haben profitiert von diesem Außenlager. Es war für die Gemeinde, die heute vielleicht knapp 2500 Einwohner zählt, in Zeiten des 2. Weltkrieges der größte Arbeitgeber. Das KZ-Außenlager Schlieben-Berga war damals allgegenwärtig, sichtbar, Quelle des Einkommens für die einen, Bedrohung, Alptraum und Ende ihres Lebens für die anderen.
Zum Ende des Krieges, als die Alliierten immer näher kamen, wurde das Lager aufgelöst und die meisten Häftlinge nach Theresienstadt abtransportiert. Der Rest von ihnen wurde durch die Rote Armee im April 1945 befreit.
Nach dem Krieg wurden die Baracken umfirmiert zu Wohnstätten für die vielen Umsiedler, die aus den ehemaligen Ostgebieten und dem tschechischen Sudetenland in die damalige Sowjetische Besatzungszone (SBZ) kamen. Sie richteten sich dort ein. Der Ortsteil von Schlieben, Berga wurde dort bis in die 90er hinein bewohnt. Die Bewohner und Anwohner wussten immer auf welchem Gelände sie hier wohnten. Erst mit dem Wegzug der meisten drängte sich die Frage auf, welche Zukunft dieser Ort haben sollte.
Es ist Uwe Dannhauer und seiner Familie zu verdanken, dass die Idee, hier eine Gedenkstätte einzurichten, sich im Ort Schlieben, im Kreis Elbe – Elster und dem Land Brandenburg durchsetzen konnte. Dannhauer gründete einen Förderverein, dem die gesamte künftige Gedenkstättenarbeit an diesem Ort bis in unsere Tage hinein zu verdanken ist. Zwar gab es befürwortende Unterstützung durch das Landesdenkmalamt und das archäologische Museum von Wünsdorf, die sicher wichtig war. Aber finanzielle Unterstützung ist rar, schwer und mühsam zu bekommen.
Kurz, es fehlt für eine angemessene Betreuung der Besucher und den Betrieb der Gedenkstätte. Der Förderverein lebt von seinem ehrenamtlichen Engagement. Und wohl auch zum Teil privaten Mitteln, die in die Gedenkstätte hineinfließen.
Dringend nötig ist eine finanzielle und inhaltliche Unterstützung des Vereins, damit er auch seine Öffnungszeiten erweitern kann, damit er die Betriebskosten für Strom und Heizung stemmen kann, damit er auf die vielen Kooperationsanfragen durch Schulen und Schülerprojekte vollständig erfüllen kann, damit hier das Gedenken an diesen schlimmen Ort weiterhin angemessen und professionell unterstützt und organisiert werden kann.
Schlieben-Berga ist ein Ort, an dem wir Gegenwärtige uns reiben. Und das ist auch gut so. Heute fast 80 Jahre nach Kriegsende, wenn wir dort stehen, merken wir, dass immer noch und immer wieder Fragen auftauchen, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Was geht uns das an? Ist das nicht lange schon her? Unserem Kopf fallen die Antworten schwer. Das ist keine Angelegenheit der kognitiven Leichtigkeit. Man muss sich Mühe geben, um sein Verhältnis zu einem solchen Ort, zu unserer Geschichte, zu unserer Verantwortung zu klären. Man braucht Zeit dafür und Energie.
Das geht auch, und insbesondere den Einwohnern von Schlieben so. Persönlich lebt wohl kaum noch einer, der sich an das ehemalige KZ-Außenlager, als es noch in Betrieb war erinnern kann, aber in die Familiengeschichten der Einwohner ist es doch fest integriert. Doch nicht wenige Einwohner tun sich schwer damit. Und lieber vernichten sie noch existierenden Artefakte, also Fotos z.B., die ihre Großeltern im KZ-Außenlager zeigen, weil sie nicht wollen, dass sie in den Vitrinen der Gedenkstätte zur Schau gestellt werden, oder gar namentlich genannt.
Da ist Scham, sicher, da ist auch Verdrängung.
Wir kommen nicht drum herum, anzuerkennen, dass die Nazizeit mit all ihren Verbrechen Teil unserer deutschen Geschichte ist. Gerade weil sie uns belastet, gerade deshalb müssen wir sie anerkennen. Sie ruft danach. Und sie rächt sich, wenn wir sie verdrängen. Von denen, die sie persönlich erlebt haben, die persönlich schuldig geworden sind am Terrorsystem der Nazis lebt kaum noch jemand. Persönliche Schuld trifft uns Nachgeborene nicht. Aber die Schuld, die unser Volk, unsere Gesellschaft, unser Staat damit auf sich geladen hat, dazu müssen wir uns bekennen. Wir stehen in ihrer Nachfolge, und wir müssen uns damit auseinandersetzen: wie es hat dazu kommen können, warum so viele Deutsche mitgemacht und geschwiegen haben, warum sie sich haben von den Nazis zu Mittätern machen lassen, ja warum sie selber zu Nazis wurden, und es blieben über die Nachkriegszeit hinaus, und warum sie sich an den Verbrechen der Nazis beteiligt haben.
Das KZ-Außenlager Schlieben-Berga ist kein Einzelfall. Es gab nach einer Auflistung des Landesjugendrings über 50 dieser Lager allein auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg. Rechnet man das hoch, so sind es wohl über 300 Außenlager in Ostdeutschland gewesen, in der ganzen Bundesrepublik ist das locker eine vierstellige Zahl. Wir wissen gar nicht genau, wie viele dieser ehemaligen KZ-Außenlager heute eine Gedenkstätte haben, und wie daran erinnert wird. Es wird Zeit, eine Bestandsaufnahme davon vorzunehmen. Und dann wäre zu entscheiden, wie Bund und Länder das Gedenken vor Ort unterstützen können. Unterstützen müssen sie es. Eine Verdrängung dieser Geschichte, und der damit einhergehenden Gefahr einer Instrumentalisierung bspw. durch die AfD können wir uns nicht leisten. Dem sollten wir entgegentreten.
Im Land Brandenburg hat sich jetzt die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten daran gemacht, Unterstützungsstrukturen für die ehemaligen Außenlager aufzubauen. Das ist wichtig. Aber das ist nur ein Schritt. Die nächsten müssen folgen. Wir stehen in der Pflicht dazu; und unsere Politik auch.
Nachtrag:
Gestern Abend hat sich die SPD des zuständigen Landkreises Elbe-Elster zu Wort gemeldet. Sie will sich dieses Themas annehmen. Das mag noch nicht viel sein. Aber er kann vielleicht einen kleinen Stein ins Rollen bringen, der dann viele andere mitreißt.
Mi
29
Mär
2023
Auch die Grünen machen Fehler
Ein Beispiel ist Bettina Jarrasch.
Nach meinem Eindruck war sie eine Kompromiss-Kandidatin für die Spitzenposition der Berliner Grünen bei der vorletzten Abgeordnetenhauswahl, also jener Wahl, die wegen der gravierenden handwerklichen Fehler in ihrer Durchführung jetzt noch einmal wiederholt werden musste. Die Berliner Grünen hätten durchaus Sympathie-Kandidaten und bekannte Figuren gehabt, die in Berlin gut angekommen wären. Aber die konnten sich nicht einigen, und wollten es wohl auch nicht. So verständigten sie sich auf die bis dahin nahezu unbekannte Frau Jarrasch, und lobten sich öffentlich ihrer Klugheit. Doch genau diese Entscheidung sollte sich als verhängnisvoll erweisen.
Zum Zeitpunkt der Nominierung von Frau Jarrasch hatten die Grünen gerade keinen Hype, aber als es zur Wahl kam schon. Aber noch größer war der Hype der SPD, die mit ihrer Spitzenkandidatin, der bis dahin quasi unverbrauchten Franziska Giffey gut punkten konnten, und die es geschafft hatte, die SPD zur Mehrheitssiegerin zu machen.
Der Ausgang der Wahl war denkbar knapp, und der Vorsprung von Franziska Giffey in den Umfragen schwand dahin. Zum Schluss landeten die Grünen nur knapp hinter der SPD.
Schon bei dieser Wahl also hätten die Berliner Grünen es mit einer anderen Kandidatin vielleicht geschafft, ins Rote Rathaus einzuziehen. Vielleicht. Mit Bettina Jarrasch haben sie es nicht geschafft.
Dann wurde in Berlin Rot rot grün fortgesetzt. Für die Grünen verhandelte Bettina Jarrasch. Und Insiderkreise kolportierten, dass Frau Jarrasch, eine, vorsichtig ausgedrückt, schwierige Verhandlungspartnerin war: besserwisserisch, unbelehrbar, zänkisch.
Die Grünen waren nicht der Traumpartner für Franziska Giffey. Die hätte damals schon angesichts der größeren inhaltlichen Nähe in wichtigen Sachthemen wohl die CDU bevorzugt. Aber das schien sie der SPD nicht zumuten zu wollen. So gab sich Franziska Giffey mit dem von ihr ungeliebten rot-grün-rot zufrieden, auf ihre Popularität vertrauend, und auf ihre Art der öffentlichen Kommunikation, die ihr den Ruf einer Macherin verschaffte, eine Hoffnungsträgerin eben, in der der alte Typ eines Politikers wieder aufschien, der keine Angst vor den Leuten hat, der das Gespräch sucht, der die Brennpunkte aufsucht, der vor Ort ist, der zuhören kann, der sich stellt, und der anpackt. Auf eine Kraft also, die jenseits der Fesseln eines Koalitionsvertrages das in ihren Augen wünschenswerte und vernünftige durchsetzen konnte.
Der ausgehandelte Koalitionsvertrag entsprach nicht den Wünschen von Franziska Giffey insbesondere in der Verkehrspolitik oder beim Öffentlichen Nahverkehr. Er setzte die falschen Prioritäten: kaum ein Wort zur U-Bahn, statt dessen Bevorzugung der Tram, keine Entscheidung für den Weiterbau der A100 trotz Baurechts, usw..
Am Anfang hörte man nicht viel aus dem Senat. Aber dann merkte man schon, schlicht am Agieren der Regierenden Bürgermeisterin Giffey, dass sie versuchte in ihren öffentlichen Auftritten vollendete Tatsachen zu schaffen. Dass sie dabei auch in Themen wandelte, die Herzensangelegenheiten der Grünen waren, störte sie nicht, im Gegenteil, es war ihr herzlich egal. Im Grunde war es ja ihre Strategie. Vollendete Tatsachen schaffen, die von ihren Partnern zähneknirschend akzeptiert werden mussten, es sei denn sie protestierten öffentlich und unter Verletzung des Loyalitätsgebots, ohne dass keine Koalition eine Legislaturperiode überstehen kann.
Besonders schwer scheint das der Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Bettina Jarrasch gefallen zu sein. Im Stil einer Umweltaktivistin, die sie im Grunde ist, verprellte sie nicht nur die Regierende Bürgermeisterin, sondern noch mehr den Bürger: Auto-Parkplätze für Fahrräder, Einschränkung des Autoverkehrs durch Verknappung des Park- und Fahrraums, Hinnahme, ja geradezu Instrumentalisierung der täglichen Staus auf den Berliner Straßen. Jarrasch schien die Berliner gerade zwingen zu wollen, auf den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, trotz fehlender Kapazitäten und langen Fahrzeiten. Und eine Perspektive für die Verbesserung des ÖPNV bot sie mit ihrem Vorhaben des Ausbaus der Tram nicht. Aber einer effektiven Verbesserung des ÖPNV, der in Berlin nur durch den Ausbau des U-Bahn-Systems möglich ist, verweigerten sich die Grünen, an ihrer Spitze, Bettina Jarrasch, mit dem Verweis auf die CO2 - Bilanz des U-Bahn-Baus. Das war nicht wirklich ehrlich, denn zur ökologischen Bewertung des ÖPNV-Ausbaus mittels U-Bahnen müsste man den gesamten Lebenszyklus dieses Verkehrsträgers betrachten, und dass der angesichts der hohen Taktzahl und Kapazitäten verbunden mit Pünktlichkeit, schlechter sein soll, als bei der Tram, erscheint mir nicht glaubhaft zu sein.
Hier schwelte ein für die rot-rot-grüne Koalition offener Konflikt, in dem Bettina Jarrasch unbeirrt ihre öffentlichen Prioritäten setzte. Und das gipfelte in der Umwidmung der Friedrichstraße zur Fußgängerzone. Damit aber überschritt die Umweltsenatorin eine Grenze. Die Geschäftsinhaber der Einzelhandelsläden, die ohnehin unter der erstarkten Konkurrenz der gewaltigen Berliner Malls litten, nahm sie die letzten Kunden weg, nämlich jene, die mit Auto einkaufen fuhren. Die anderen fuhren ohnehin schon lieber ins Alexa, oder in der Berlin-Mall.
Franziska Giffey wollte das nicht, offenkundig. Ihr Herz schlug für die Ladenbesitzer, deren Nöte sie gut nachvollzog. Bettina Jarrasch aber versuchte ihren Kopf durchzusetzen, und machte dabei noch schwere handwerkliche Fehler. So konnten die Ladeninhaber per Gerichtsbeschluss die Straße wieder für den Autoverkehr öffnen, nicht ohne dass sich die Regierende und ihre Senatorin ein öffentliches Gemetzel lieferten, das es in sich hatte, und das zeigte, wie zerrüttet das Verhältnis inzwischen war. So unterstellte Frau Jarrasch ihrer Regierenden schlicht, dass sie das Gerichtsurteil gar nicht gelesen hätte, und erst recht nicht verstanden. Und dass die Friedrichstrasse so oder so, zur Fußgängerzone würde.
Jetzt verstand jeder in Berlin, dass die Koalition am Ende war.
Dafür hätte es des Neuwahltermins, ausgelöst von der Berliner Verwaltungsmisere um die vorherige Abgeordnetenhauswahl, für das ausschließlich die SPD die politische Verantwortung trug, gar nicht bedurft.
Kurz Jarrasch war alles andere als geschickt vorgegangen. Zur Gilde der grünen Sympathieträger wie Habeck, oder Özdemir, oder Wolfgang Wieland oder auch Ramona Pop gehört sie nicht. Die hätten vielleicht eine Lösung für die Konflikte mit der SPD gefunden. Aber Bettina Jarrasch wollte das gar nicht. Sie hat sie gar nicht gesucht.
Als Aktivistin will man auch keine Kompromisse. Vielmehr setzt man auf Anecken, auf Aufmerksamkeit schaffen durch Aktionen, selbst wenn diese verärgern, stressen oder nötigen. Das sind Grenzüberschreitungen, die hingenommen, ja im großen Stil unterstützt werden, wenn es um wichtige Grundrechte geht, wie bei den Begründern der Aktionen des zivilen Ungehorsams, Mahatma Ghandi und Martin Luther King.
Doch Klimaschutz, Fahrradverkehre, Einschränkungen des Autoverkehrs gehören nicht zu unseren Grundrechten, auch wenn sie von ihren Lobbyisten dazu erklärt werden.
In einer offenen Gesellschaft freier Menschen darf man in der Politik nur als letztes Mittel von freiheitseinschränkenden Mitteln Gebrauch machen. Wichtiger ist eine Strategie, die den Bürgern aus ihrer alltäglichen Lebenssituation heraus das für die Allgemeinheit vernünftige Individual-verhalten nahelegt. Das ist schwierig, aber geht. Der Ausbau der U-Bahn in Kombination mit autonom fahrenden Elektroautos könnte die tägliche Fahrt zur Arbeit in der Innenstadt für die Bewohner der Randbezirke und der Vor-Ort-Gemeinden von ganz alleine nahelegen, weil es zeitlich und finanziell Vorteile bringt.
Das wissen große Teile bei den Grünen auch. Und da wo sie das Sagen haben, schaffen sie es sehr wohl, immer größere Schichten an Wählern zu erreichten. Von alleine ist der Hype der Grünen ja nicht entstanden, das grüne Thema an sich, kann, wie man an Frau Jarrasch auch verprellen.
Und hätte jetzt eine Ramona Popp zum Beispiel an der Spitze der Berliner Grünen gestanden, dann wäre sie längst ins Rote Rathaus eingezogen, dann würde jetzt Kai Wegner von der CDU mit ihr den neuen Koalitionsvertrag aushandeln. Aber auf die Aktivistin Jarrasch hatte er, der ja die Wahl gewonnen hat, nachvollziehbarer Weise keine Lust, weshalb es der SPD in einer listigen Volte gelungen ist, die Grünen aus dem Machtpoker um die Macht in Berlin auszuschließen.
Kurz die Grünen haben sich ins Knie geschossen. Gut, dass das nicht immer nur die eigene Partei macht.
Di
28
Mär
2023
Glück gehabt – zum Abstimmungsergebnis über den Volksentscheid „Klimaneutrales Berlin 2030“
Die Berliner Landespolitik ist mit einem blauen Auge davon gekommen.
Und es wundert mich wie regungslos und starr sie der Kampagne für den Volksentscheid zugesehen hat, ohne irgendwelche eigenen Aktivitäten zur Aufklärung der Bevölkerung über die schädlichen Folgen einer Zustimmung zum Anliegen der Unterstützer und Befürworter dieses Volksentscheides beizusteuern.
Dass die Berliner Wahlbevölkerung dennoch diesen Volksentscheid abgelehnt hat, ist einigen Einzelstimmen, einer kritischen Begleitmusik in den Medien, die aber erst in den letzten zehn Tagen vor dem Volksentscheid einsetzte, und natürlich dem Quorum zu verdanken, das der Gesetzgeber als Hürde für den Erfolg eines solchen Volksentscheides eingebaut hat, und das aus guten Gründen.
Die politischen Parteien sind nicht nur dazu da, im Parlament zu debattieren, zu regieren, oder Gesetze zu diskutieren und zu verabschieden. Sie haben auch die Aufgabe politische Orientierungen zu liefern, wenn es nötig wird und wenn es geboten erscheint. Dieser Aufgabe sind die Berliner Parteien im Vorfeld dieses Volksentscheides nicht nachgekommen.
Plebiszitäre Elemente, die seit den 90er Jahren vermehrt in die deutsche Politik Einzug gehalten haben, verändern die Spielregeln der politischen Auseinandersetzungen, aber sie sind nun wirklich kein Grund für die Sprachlosigkeit, die in Berlin vor diesem Volksentscheid geherrscht hat.
Es ist legitim, dass die Initiatoren des Volksentscheides eine so große Kampagne gefahren haben, und dass es ihnen gelungen ist, finanzielle Mittel dafür einzuwerben. Doch dass ihnen die anderen politischen Akteure nahezu kampflos den öffentlichen Raum überlassen haben, das war ein Akt politischer Dummheit. Dabei hätte Berlin ja eigentlich aus den Erfahrungen über den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld lernen können.
Wenn aber immer nur die Initiatoren eines Volksentscheides für ihre Sache werben, dann werden bald Partikularinteressen die politische Landschaft beherrschen.
Es war schon zu merken, dass CDU, SPD oder FDP keineswegs zu Befürwortern von „Klimaneutrales Berlin 2030“ gehört haben, aber öffentlich Stellung dazu bezogen, gar mit eigenen Plakaten dagegen aufgetreten sind, für ihre eigenen Positionen geworben, haben sie nicht.
Nochmal, man darf für ein klimaneutrales Berlin 2030 sein, man darf auch dafür werben, aber man darf auch sagen, wie unrealistisch, unbezahlbar das geworden wäre. Und wenn eine Seite eine Kampagne fährt, dann müssen die anderen politischen Parteien für ihre Positionen und deren Durchsetzung eine Gegenstrategie entwickeln, dann müssen sie eine Gegenkampagne fahren.
Plebiszitäre Elemente sind gut und schön. Sie mögen dazu beitragen, den Volks- oder besser Wählerwillen stärker zu repräsentieren. Doch das macht die Interessen derjenigen, die sich des Mittels plebiszitärer Elemente bedienen, noch nicht überlegen, noch nicht sakrosant. Volksentscheide verlagern politische Sachentscheidungen jenseits von Wahlkämpfen raus aus den Parlamenten unmittelbar in den öffentlichen Raum. Und dann müssen sich die Parteien eben an diesen Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum auch beteiligen.
Kurz, dann gehört es auch zur Pflicht eines politischen Bürgers, einen Volksentscheid abzulehnen, wenn er einem nicht passt. Dann reicht es nicht, sich auf ein Quorum zu verlassen. Doch das muss man den Leuten auch sagen.
Volksentscheide haben ihre eigenen Spielregeln. Wer aber gar nicht erst mitspielen will, der überlässt den politischen Raum den Initiatoren dieser Plebiszite.
Es zeigt sich, dass diese in Deutschland relativ neuen Elemente der politischen Entscheidungsfindung, das politische Geschäft nicht erleichtern. Aber man kann damit umgehen. Sie sind jetzt da, und ich will sie nicht abschaffen. Aber ich will, dass die Parteien verantwortungsbewusster damit umgehen.
Fr
09
Sep
2022
Stolpes Stasi - Kontakte, Bedeutung und Konfliktlage, eine Einführung
In Dietz-Verlag ist dieser Tage ein Buch erschienen, welches sich mit der Geschichte der Brandenburger Sozialdemokratie beschäftigt im Zeitrahmen von der Spätphase der Weimarer Republik über die Machtergreifung der Nazis, der sowjetischen Besetzung, über die DDR bis zu ihrer Demokratisierung und der Wiedererstehung Brandenburgs als Bundesland.
Ich habe dieses Buch besprochen.
Natürlich wird in diesem Buch auch Manfred Stolpe gewürdigt, der der erste Ministerpräsident dieses neu gegründeten Landes 1990 wurde, und der Land und SPD entscheidend mitgeprägt hat. Gleichwohl war er eine zutiefst umstrittene Persönlichkeit. Seine Stasi-Kontakte haben damals zu einer der heftigsten Debatten im wiedervereinigten Deutschland geführt. Ich hatte immer meine Meinung dazu, und habe sie auch geäußert. Die Brandenburger SPD hat sich um ihn geschart, und die problematischen Seiten von Stolpe nicht wahrhaben wollen. Dieser Linie ist das Buch "Sozialdemokratie in Brandenburg (1933-1989/90)" treu geblieben. Was Stolpe betrifft ist das Hofberichterstattung. Daher will ich versuchen, was das Buch nicht leistet, in die Konfliktlage um die Stolpeschen Stasi-Kontakte einzuführen.
Diesen Versuch veröffentliche ich hier als Blog. Die gesamte Besprechung findet sich hier.
Die Rolle Stolpes in Bezug auf seine Haltung zur DDR und zur SED-Diktatur wurde schon lange strittig diskutiert, bevor überhaupt das Ende der DDR in sichtbare Nähe geriet. Stolpe trug erheblich dazu bei, dass die Kirche sich als Institution und ihren kirchenleitenden Repräsentanten in Bezug auf die DDR versuchte neu zu ordnen - weg von der harten Konfrontationslinie der 50er Jahre, in der das SED-Unrecht gegenüber der Gesellschaft und ihren Bürgern klar benannt und kritisiert wurde, hin zu einer Art Arrangement mit der SED-Diktatur und ihrem Staat, der DDR, der man das Existenzrecht nicht mehr absprach, und wo sich die evangelische Kirche mehr auf die politischen Verhältnisse einzustellen versuchte, als sie permanent in Frage zu stellen. Das problematische dieser Haltung bestand quasi in einer Hinnahme des von der DDR gegenüber ihren Bürgern praktizierten Unrechts, wodurch die Kirche in eine Art Komplizenschaft geriet, der sie nicht wenigen DDR-Bürgern verdächtig machte. Diesen Weg ging in der Kirche nicht jeder mit, und die sich innerhalb der Kirche nach dem Mauerbau 1961 neuformierende DDR-Opposition schon gar nicht. Diese hatte einen ganz anderen Ansatz. Sie stellte die Legitimität des SED-Regimes grundsätzlich in Frage und ließ sich von der SED die eigene, auch persönliche Verantwortung für Land und Leute nicht absprechen. Sie entwickelte von daher eigene, neue Protestformen gegen den DDR-Sozialismus, mit denen sie interessanterweise nun nicht nur in (einen gewollten) Konflikt mit der SED geriet, sondern interessanterweise auch mit ihrer Kirchenobrigkeit, die sich den fragilen Burgfrieden mit der SED-Spitze nicht durch die in ihren Augen provokanten und nicht selten auch spontihaften Aktionen der sich in den berühmten kleinen Gruppen organisierenden DDR-Opposition in Frage stellen lassen wollte. Gleichwohl gelang dieser Opposition neben ihrer zunehmend politischen Profilierung auch etwas, von der die übrige Kirche nur träumen konnte. Die Kirche wurde wieder, zwar anfangs erst langsam, auch für kirchenferne Schichten attraktiv. Und das war insofern kein Zufall, weil die DDR-Opposition eben selbst Kirche war, zwar nicht repräsentiert durch die Kirchenobrigkeit, aber als gläubige Christen bis hin zu vielen kirchlichen Mitarbeitern eben doch Teil von ihr. Sie brauchte gar nicht erst unter das Dach der Kirche zu schlüpfen, sie war da schon lange vorher. Sie war ein eigenes christliches und letztlich auch kirchliches Gewächs. Und in dieser wurde die Rolle von Stolpe zunehmend kritisch diskutiert. Denn Stolpe rückte die Kirche immer stärker in die Nähe der SED-Diktatur mit der er gemeinsame Werte und Traditionen beschwor; er versuchte den Kirche-Staat-Konflikt zu deeskalieren, in dem er bspw. seinen eigenen Bischof Forck 1988 antrug, der Einweihung des sanierten Greifswalder Doms fernzubleiben, um Honecker nicht zu verärgern, und er half dem inzwischen mit dem Rücken an der Wand stehenden SED-Regime bei der Lösung des Konflikts um die Inhaftierten der Rosa-Luxemburg-Demonstration 1988, der damals schon zu einem Auslöser der erst im Herbst 1989 ausbrechenden friedlichen Revolution hätte werden können. Auch dies sind nur Beispiele. Stolpe war also keineswegs der unumstrittene, liebevolle, helfende Kirchenvertreter, an den sich in Not geratene Bürger und Kirchenmitglieder vertrauensvoll wenden konnten, und die nicht selten berichteten, wie ihnen Stolpe tatsächlich geholfen habe. Seine politische Funktion bestand in der Aufrechterhaltung einer kirchlichen Position, die den Machtanspruch der SED-Herrschaft nicht in Frage gestellt sehen wollte, sondern akzeptieren, und sich damit arrangieren. Damit hätte er besser in die damalige Blockpartei CDU gepasst als in die sich neu gründende SDP, deren erklärtes Ziel die Entmachtung der SED war.
Ich war dabei, als Martin Gutzeit Anfang Dezember 1989 Thomas Krüger und Anne Katrin Pauk als Vertreter des Berliner SDP-Vorstands eine solche Abfuhr erteilte, wie ich das vorher von ihm noch nicht erlebt hatte. Beide wollten im Republik-Vorstand der SDP für eine Spitzenkandidatur von Stolpe für die SDP bei den inzwischen in greifbare Nähe gerückten ersten freien Wahlen der DDR werben. Beide verließen den Raum wieder, bevor der Vorstand überhaupt zusammengekommen war. Ich selbst hatte in meiner Funktion als 1. Sprecher der SDP der evangelischen Kirchenleitung einen Brief geschrieben, in welchem ich ihr das Recht absprach, ohne Legitimation durch das Volk, politische Positionen mit der SED zu verhandeln, gar in unserem Namen zu sprechen, weder in Bezug auf die SDP noch die Opposition als ganzer. Und jetzt sollte der Oberrepräsentant dieser Haltung, Stolpe ausgerechnet unser Spitzenkandidat werden, ein Mann, der kurz vorher noch Eppelmann davon abgehalten hatte, selbst in Sachen SPD-Gründung aktiv zu werden? Wie konnten wir, die neu gegründete SDP, deren wichtigstes Ziel die Beseitigung der SED-Diktatur war, einen Mann an die Spitze heben, dessen ganzes politisches Bemühen darin bestanden hatte, die Kirche und die Christen mit der SED-Herrschaft zu versöhnen, weil sie unabänderlich sei? Und das war sie ja seit 1985 nicht mehr. Das sah ja nun auch jeder. Stolpe allerdings erst ganz spät, zu spät. Es war ihm nicht gelungen, seine politische Position an die neue Lage anzupassen. Daher geriet er in der friedlichen Revolution in die politische Versenkung, aus der ihn Steffen Reiche im August 1990 wieder herausholte, indem er ihn dann allerdings eine Spitzenkandidatur, aber nun für den neu zu wählenden Ministerpräsidenten Brandenburgs antrug. In meinen Augen war das eine Rolle rückwärts.
Ich hatte Steffen Reiche davon abgeraten. Aber er meinte, die Messen seien schon gesungen, seine eigene Vermittler-Rolle bei dieser Spitzenkandidatur verschweigend. Später hat er sie dann in seinen Selbstzeugnissen immer wieder beschrieben. Er ist sogar stolz darauf. Das darf er von mir aus. Ein Fehler war das trotzdem. Wie groß dieser Fehler war, zeigte sich erst bei den Debatten um Stolpes Stasi-Kontakte.
Der Bundestag brachte im Herbst 1991 das Stasi-Unterlagen-Gesetz auf den Weg, mit dem das Akteneinsichtsrecht in die persönlichen Stasi-Akten realisiert wurde. Stolpe musste damit rechnen, dass viele Leser in ihren Stasi-Akten auch auf seinen Namen stoßen würden, und was sie da zu lesen bekommen würden, das würde ihm keineswegs zur Ehre angerechnet werden. Wohl deshalb kam Stolpe den Debatten zuvor, indem er kurz vorher mit einer Buchveröffentlichung von sich aus seine Stasikontakte selbst einräumte und bei der Gelegenheit sein eigenes Narrativ gleich mit. Alles sei zum Segen und Besten der Kirche und zur Lösung der ihm anvertrauten Anliegen von Bürgern der DDR, die sich SED-Repressalien ausgesetzt gesehen hatten, geschehen. Doch das reichte ihm noch nicht, er erklärte in dem Zusammenhang auch, dass die Kirche der Garant der DDR-Opposition gewesen sei, und dass er, Stolpe seine Stasi-Kontakte auch dazu genutzt habe, den wehrhaften kirchlichen Schirm über die Opposition zu halten, ihre Vertreter persönlich geschützt habe vor staatlicher Verfolgung oder sie gar wieder aus dem Gefängnis geholt habe. So gesehen, sollte ihm die DDR-Opposition eigentlich dankbar sein, meinte Stolpe, denn ohne diese Kirche, wie er sie auch gegen das MfS vertreten habe, hätte die DDR-Opposition gar nicht wirken können. Das konnte kein Vertreter der ehemaligen DDR-Opposition auf sich sitzen lassen. Denn dieses Narrativ war erstens eine Lüge auf dem Rücken der DDR-Opposition, es widersprach ihrer politischen Erfahrung, und es sprach der Opposition jeglichen Einfluss beim Zustandekommen der friedlichen Revolution und der Entmachtung der SED ab. Letztlich war dies alles der Kirche, und ihm Stolpe zu verdanken, ohne den die Opposition in den Kerkern der SED-Diktatur verschwunden wäre. Die Opposition geriet bei ihm in den Ruf, willkommenes Instrument seines segensreichen und letztlich politischen Handelns gewesen zu sein.
Nun muss man wissen, dass nichts in der DDR-Bevölkerung so verhasst war die staatliche Geheimpolizei der SED, die Stasi. Vor nichts war die Angst so groß und allgegenwärtig, wie vor diesem Schutzschild von Partei und Staat. Und nichts war so verpönt, wie eine Mitarbeit bei ihr. Mit der Debatte um Stolpes Stasi-Kontakte ging es also um die Rolle der Stasi als solcher, und die Rolle derjenigen, die hier mitgearbeitet hatten. Damit aber ging es um einen ganz wesentlichen Teil der Aufarbeitung der untergegangenen SED-Diktatur, und zwar sowohl in persönlicher Hinsicht bei den Mitarbeitern im Öffentlichen Dienst, als auch bei der Bewertung der ganzen Diktatur und ihrer Verbrechen, und es ging nicht zuletzt um die SPD, die ja in klarer Gegnerschaft zum totalitären Staat und seiner Diktatur gegründet wurde, und die sich von Anfang an der Aufarbeitung des SED-Unrechts verpflichtet wußte. Und es ging um den Widerspruch zu Stolpes Aussagen, dass die Opposition ihr Wirken seinen Stasi-Kontakten zu verdanken gehabt hätte, also letztlich die Selbstbehauptung all jener, die ihr politisches Wirken ihrem Engagement innerhalb der DDR-Opposition zu verdanken hatten. Stolpe hatte in seiner Not ein Narrativ erfunden, dass allen anderen politischen Akteuren außer der Kirche und ihm, jegliche Eigenständigkeit abgesprochen hatte. Er persönlich erhob den Anspruch der Vater allen Widerstehens gewesen zu sein.
Nebenbei relativierte er dabei gleich die Stasi mit, insbesondere die Bereitschaft eines jeden einzelnen IMs mit dieser Institution zusammengearbeitet zu haben. Sein Narrativ war geeignet, das gesamte gesellschaftliche Verhältnis zur Stasi und damit zur SED-Diktatur auf den Kopf zu stellen. Das MfS wurde von einem unberechenbaren, aggressiven Schwert gegen die einfachen Menschen zu einer von diesen beherrschbaren Institution, wenn man es denn schaffte, wie er, Stolpe, durch Cleverness und gesichert durch die Auftrag der Kirche, sich diese Institution zu Nutze zu machen und damit zu entschärfen.
Die Vertreter der ehemaligen DDR-Opposition setzten sich zur Wehr. Aber sie hatten der Professionalität von Stolpe nichts entgegenzusetzen. In den damaligen öffentlichen Diskussionen und Talkshows gingen sie sang- und klanglos unter. Sie schafften es nicht, das väterliche Fürsorge-Narrativ von Stolpe zu entkräften. Vielmehr entstand der Eindruck einer gewissen Hilflosigkeit der ehemaligen Opposition. Das half Stolpe natürlich.
Was ihm auch half, waren plumpe Attacken von einigen konservativen Medienvertretern, die ihm zum Rücktritt aufforderten, die aber gar nicht verstanden hatten, welche Wirkung sein Narrativ der Stasi-Kontakte zum Segen von Kirche und Mitbürgern entfaltete. Zumal diese Medienvertreter nicht selten aus der alten Bundesrepublik kamen und von daher den Ossi-Wessi-Konflikt, der die öffentliche Debatte beherrschte, noch bedienten. Nun schlossen sich die Ossis um „ihren“ Mann Stolpe zusammen. Er wurde ihnen zu einem Beispiel des aufrechten Ostdeutschen, der von den Westdeutschen plattgemacht werden sollte, weil er anders war als sie.
Was ihm auch half, war die Hilflosigkeit einer ganzen Reihe von Kirchenvertretern, die im Angriff auf Stolpe einen Angriff auf die gesamte evangelische Kirche in der DDR, und letztlich in Deutschland sahen. Der bruderschaftliche Geist, der in ihr beschworen wurde, schloss ihre Reihen zusammen. Was aber einige von ihnen dachten, fasste der damalige Bischof und letzte Ratsvorsitzende des Kirchenbundes in der DDR, Gottfried Forck in Worte, als er vom Erschrecken über das Ausmaß der Stasi-Kontakte von Stolpe in seiner Auslegung des kirchlichen Auftrages sprach.
Was Stolpe nicht zuletzt half, waren die handfesten Solidaritätsbekundungen der SPD, die ihren Mann im Osten, dem einzigen, der es geschafft hatte in Ostdeutschland eine Landtagswahl zu gewinnen. All das machte jede Form kritischer Anmerkungen zu Manfred Stolpe in der SDP schwierig, weil der Preis dafür eine kollektive sozialdemokratische Ausgrenzung zumindest in der Brandenburger SPD war.
Trotzdem erklärte ich, um hier mal auf meine Person zu sprechen zu kommen, der ja im Text über Stolpe zumindest erwähnt wird, in allen Gremien der SPD, dass weder die MfS-Tätigkeit noch das Narrativ von Stolpe hinnehmbar sei: im Landesvorstand, in der Landtagsfraktion und auf dem Senftenberger Landesparteitag. Auf letzterem begründete ich das mit unserer Rolle als antitotalitärer Partei, die im Kampf gegen die SED-Diktatur gegründet und siegreich gewirkt hat, und die an der Seite der Opfer der SED-Diktatur stehen müsse. Und deshalb müsse sie Stolpe auffordern, sein Amt ruhen zu lassen. Dafür wurde ich ausgebuht im Herbst 1992. Aber in meinem eigenen Landesverband gab es doch auch Stimmen, die ihr Erschrecken zeigten über die Art und Weise wie dieser mit Kritik an Stolpe umging. Was war aus der Partei geworden, die einst für Demokratie und freie Meinungsäußerung gegründet worden war?
Die erste, die bezahlte für Stolpes Verteidigungskampagne, war die SPD selbst. Ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Aufarbeitung der SED-Diktatur hatte Schaden genommen. Das nächste waren die Stasi-Überprüfungen im Lande, die ja als Teil der Aufarbeitung ihren Anteil beitragen sollten, jene, die sich in der DDR allzu sehr mit dem System eingelassen hatten, nicht mehr als Inhaber öffentlicher Ämter tragbar waren, zu entlassen. Flächendeckend wurden diese Stasi-Überprüfungen eingestellt, sogar in der Polizei und Justiz, von Hochschulen und Schulen ganz zu schweigen. Es freute sich die ehemalige SED, jetzt PDS, weil die Debatte von ihrer Verantwortung ablenkte, und es freute sich die ehemalige Blockpartei CDU, weil nun niemand mehr von ihrer Komplizenschaft mit der SED redete. Auf dem Altar der Anpassung an die SED-Diktatur, hatte die SDP/SPD selbst ihren antitotalitären Gründungsimpuls vom Oktober 1989 geopfert. Mit dieser Debatte um die Stasi-Kontakte von Manfred Stolpe war die Brandenburger SPD nicht mehr wiederzuerkennen. Sie hatte ihre einstige Lebendigkeit, ihre Debattenkultur verloren, sie wurde zu einem Unterstützerverein von Stolpe, den sie zu einem lebendigen Denkmal machte.
Die Brandenburger Ampelkoalition zerbrach über die Frage der Stasi-Kontakte von Stolpe. Marianne Birthler trat zurück, Platzeck schloss sich der SPD an, das Bürgerbündnis, dem sie angehört hatten, zerbrach und hörte auf zu existieren.
Und die ehemaligen Vertreter von Stasi und alter DDR rieben sich die Hände. Besser als mittels ihres ehemaligen IMB, Manfred Stolpe, alias „Sekretär“ hätten sie gar keine Verharmlosungslegenden über das Wirken des MfS erfinden können.
Dass ich selbst meine Kritik an diesem Verhalten von Stolpe 1992 politisch überlebt habe, verdankte ich meinem Wirken in der SPD-Bundestagsfraktion, die nicht bereit war, ihr Verhältnis zu mir, meinem Verhältnis zu Manfred Stolpe unterzuordnen. Im Gegenteil, ich machte hier Karriere, wurde Bildungssprecher, in den Fraktionsvorstand gewählt und später Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium in der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder, und nahm damit, aber das nur nebenbei, als erster Brandenburger Sozialdemokrat an Sitzungen des Bundeskabinetts teil. Aber die Debatte um Stolpe verfolgte mich. Und da ich mich neben meiner bildungspolitischen Tätigkeit generell mit Aufarbeitungsthemen beschäftigte, blieb es nicht aus, dass ich auch immer wieder meine Kritik an der Handhabung der Stolpeschen Stasi-Kontakte erneuerte.
Als Stolpe dann zum Bundesminister meines eigenen Ministeriums berufen wurde, spitzte sich für mich die Situation zu. Es ging darum, Glaubwürdigkeit und Perspektive in Einklang zu bringen. Mit dem Satz: „Mit Stolpe hat die Firma am Kabinettstisch Platz genommen.“ verabschiedete ich mich letztlich von meiner politischen Karriere. Einzig dieser Satz ist es, der die Herausgeber des Buches über die Brandenburgische Geschichte der SPD bis 89/90 hatte sagen lassen, hier seien auch die Kritiker von Stolpe zu Worte gekommen.
Stolpe hat viel gelogen in seiner politischen Karriere, und er ist lange damit durchgekommen. Er hat die Demokratie nicht angestrebt, er hat sie benutzt. Er ist der intelligente Vertreter einer Schicht, die in der Lage ist, sich an alle politischen Verhältnisse anzupassen, und sich zu Nutze zu machen. Es interessierte ihn nicht, was er früher gesagt hat, oder nicht, wenn es denn seinem Fortkommen nutzte. Bei ihm kann man studieren, was Professionalität auch bedeutet. Was Integrität bedeutet, braucht allerdings andere Lehrmeister.
Sa
16
Jul
2022
Schröder aus der SPD ausschließen? Hoffentlich nicht!
Ich kann nur hoffen, dass die Schiedskommission der SPD weise mit den vielen Anträgen umgeht, ihren ehemaligen Vorsitzenden und Bundeskanzler Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen.
Man legt ihm seine Tätigkeit für Gasprom, und seine Freundschaft zu Putin zur Last. Parteischädigend sei das, so heißt das in den Ausschlussanträgen.
Schröder hat seine Tätigkeit für und bei russischen Ölkonzernen und seine Lobbydienste für Putin noch für vernünftig gehalten, da hatte letzterer schon die Krim annektiert, und im Donbass gezündelt, politische Morde im eigenen Land und im Ausland angeordnet, Kritiker vergiftet, die Opposition marginalisiert, die Justiz zum Handlanger des Kreml degradiert, sein mafia-ähnliches Patronatssystem mit vielen ehemaligen KGB-Kumpeln an den Schaltstellen des russischen Staates etabliert, kurz eine Diktatur im eigenen Land errichtet, und er war zu einer Quelle der Angst nicht nur im eigenen Land geworden, sondern vermehrt auch im osteuropäischen Ausland. Statt sich mit seiner Kanzler-a.D.-Autorität für eine neue konstruktiv-distanzierte Politik gegenüber dem sich immer aggressiver gebärdenden russischen Präsidenten Putin einzusetzen, sonnte sich Schröder in seinem Glanze, machte sich zu seinem verlängerten Arm in Sachen Energiepolitik für Deutschland, und unterstützte gegen den Rat der EU eine Energiepolitik für Deutschland, die dieses Land in die größte Abhängigkeit gegenüber Russland führte, die vielleicht je in der langen Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen existiert hat.
Deutschland hat diese Politik heute auszubaden, leider nicht nur Deutschland. Vor allem die Ukraine, die sich einem russischen Vernichtungsfeldzug ausgesetzt sieht, und die immer auf die Folgen dieser deutschen Energiepolitik für die eigene Sicherheit hingewiesen hat, für die wir heute mit Milliardenbeträgen und immensen Waffenlieferungen unterstützen müssen, leidet unter den Folgen einer falschen geostrategischen Einschätzung, für die Gerhard Schröder mitverantwortlich zeichnet.
Das alles kann man Schröder zur Last legen, zu Recht.
Doch ihn aus der eigenen Partei ausschließen zu wollen, hat etwas Kleinkariertes, etwas Kleinbürgerliches, ja Verbiestertes an sich. So etwas wollen vielleicht affektuöse Typen, die impulsgesteuert sind, wie dreijährige Kinder, die erst gerade dabei sind, ihren Verstand zu entwickeln, oder Testosteron-gesteuerte Erwachsene, die sich ihren Emotionen überlassen, ohne Rücksicht auf Konsequenzen.
Es sieht so aus, als wolle man Schröder ganz allein für eine Politik verantwortlich machen, die doch in der SPD auf breite Zustimmung gestoßen ist. Hätten doch diejenigen, die ihn heute ausschließen wollen, beizeiten den Mund aufgemacht! Hätten sie vor allem reflektiert und thematisiert, in welchem Begründungszusammenhang Schröders Verhalten steht! Da hätten sie was lernen können, und würden sich nicht einfach nur an ihm persönlich abarbeiten.
Das erste was mich an den Ausschluss-Anträgen stört, ist die extreme Einseitigkeit, mit der Schröders Wirken als Ex-Parteivorsitzender und Bundeskanzler a.D. bewertet wird. Man kann niemanden auf seine Fehler reduzieren, nicht mal dann, wenn diese schwer wiegen.
Deshalb ist es wichtig, seine Verdienste zu benennen: Er war derjenige, der nach 16 Jahren die SPD auf der Bundesebene wieder zur führenden politischen Kraft gemacht hat, er war der dritte sozialdemokratische Bundeskanzler in der Geschichte der SPD und er hat die erste rot-grüne Bundesregierung gebildet.
Er hat als Bundeskanzler Deutschland modernisiert, nicht nur in Sachen Staatsbürgerschaftsrecht, sondern auch in Sachen Globalisierung und Internationalisierung, auch in Sachen internationalen Kapitals, was frisches Kapital nach Deutschland brachte, womit der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt wurde.
Es ist richtig, er war verantwortlich für den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr nach dem 2. Weltkrieg, dem Kosovo-Krieg, gemeinsam mit den europäischen und atlantischen Partnern. Er verweigerte sich den deutschen Verpflichtungen gegenüber der NATO und EU nicht, wie es noch Helmut Kohl praktiziert hatte. Er beendete hiermit die deutsche Sonderrolle, und stellte sich vorbehaltlos in die transatlantische Partnerschaft. Und als unter anderem auch wegen dieser Politik sich der damalige SPD-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Lafontaine bei Nacht und Nebel vom Acker machte und alle Ämter niederlegte, übernahm Schröder den Parteivorsitz und stabilisierte die von diesem Schritt Lafontaines verunsicherte Partei wieder.
Aber Schröder war in Sachen Auslandseinsatz kein willfähriger Gefolgsmann der USA. Sein Nein zum Irak-Krieg gehört zu seinen Glanztaten. Es hat ihm in der Bundesrepublik, aber auch im Ausland viel Anerkennung eingebracht. Unter ihm war Deutschland in der Lage selbständig und souverän zu entscheiden.
Und nicht zuletzt ist es Gerhard Schröder zu verdanken, dass der deutsche Arbeitsmarkt wieder flottgemacht werden konnte,
dass sein Dysfunktionalität überwunden werden konnte, und damit der Grundstein für das anschließende Jahrzehnt, in dem Deutschland faktisch die Vollbeschäftigung erreichen konnte, gelegt wurde. Damit überwand die Bundesrepublik ihre Schuldenfalle, und wenn wir heute den vielen Krisen unserer Tage, Corona, Energiekrise einigermaßen gefasst ins Auge sehen können, ist das auch einem gesunden Bundesfinanzhaushalt zu verdanken, der wiederum ohne die Hartz-Gesetze unerreichbar geblieben wäre.
All das spielt bei den Ausschluss-Anträgen keine Rolle. Hier wird nicht abgewogen, hier wird einfach nur ein Sündenbock gejagt.
Hatte denn Schröder denn keine Unterstützung für seine Politik? Stand seine SPD nicht hinter ihm, wenn auch zugegebenermaßen gelegentlich mit einigen Mühen und unter Wehklagen.
Ja, Schröder hat ein gutes Verhältnis zu Russland angestrebt. Ja, Schröder hat der Bedeutung Russlands eine größere Bedeutung beigemessen als der antidemokratischen Entwicklung in diesem Land. Er hat Putin gefeiert und sich von ihm bezirzen lassen.
Dabei hat er sich von Bismarck beeinflussen lassen, ausgerechnet Bismarck, dem stärksten Anwalt des kaiserlichen, deutschen Adelsstaates, dem Verfolger der Sozialdemokraten. Schröders Nachahmungsversuche der Bismarck‘schen Großmachtpolitik waren von Anfang an aus der Zeit gefallen. Europa war nicht mehr der Kontinent der überlebten absolutistischen Adelsreiche, Europa war demokratisch geworden, und die europäische Friedensordnung basierte auf der Demokratie der europäischen Staatengemeinschaft. Unser heutiges Europa braucht keine Russland-Politik mehr, wie sie Bismarck betrieben hat, die den russischen Expansionsdrang schlicht als gegeben hinnahm, was er wohl als Realpolitik verstand, und der ihm die Interessen der kleinen Nachbarstaaten zu opfern bereit war, wie damals bei Finnland, Polen oder dem Baltikum.
Die anhaltende Rückwärtsentwicklung des demokratischen Rechtsstaates in Russland war von Anfang an eine Belastung nicht für die offene Gesellschaft in Russland selbst, sondern auch seiner Nachbarländer. Und der militärische Einsatz russischen Militärs in Tschetschenien war ein Sündenfall, der nicht nur mit dem wichtigsten Prinzip der Gorbatschow‘schen Außenpolitik brach, dem Gewaltverzicht, sondern er markierte auch den Wendepunkt der demokratischen Entwicklung in Russland. Das alles hat Schröder nicht angefochten. Diese Zusammenhänge interessierten ihn nicht. Er hielt einem Russlandbild die Treue, das aus der Zeit gefallen war, selbst in jenen Momenten, als selbst ihm, dem Juristen Schröder und Kenner des Völkerrechts klar war, wie sehr Putin zu einer Gefahr für den europäischen Frieden geworden war.
Aber hat Schröder das allein getan? Und haben die Regierungen Merkel nicht diese Politik allesamt fortgesetzt bis zum bitteren Ende. Sogar die Scholz’sche Ampelregierung hat diese Politik noch weiterbetrieben bis zum Tag des Einmarschs der russischen Truppen in die Ukraine im letzten Februar. Und erst Scholz war es, der die Konsequenzen aus diesem Verhalten zog.
Schröders Russland-Politik steht nicht für ihn allein, sie steht für den Mainstream der bundesdeutschen Russland Politik, die sehenden Auges in die Energieabhängigkeit von Russland führte, die die Sicherheitsbedenken der EU aber auch Polens, des Baltikums und vor allem der Ukraine ungerührt beiseiteschob.
Wer heute Schröder aus der SPD ausschließen will, der will von eigener Verantwortung, und der Verantwortung der SPD als Gesamtpartei nichts wissen. Der zeigt mit dem Finger auf die Person Schröder, und er geißelt ihn im Stile der grassierenden Cancel culture. Was wäre denn gewonnen, mit einem Ausschluss Schröders aus der SPD? Wäre dann unsere Parteigeschichte eine andere? Wäre dann die Verantwortung der SPD für die blamable Lage Deutschlands in Sachen Russland und Energiepolitik eine andere? Wäre die Geschichte eine andere?
Und würde man, wenn man die Fehler der deutschen Russland Politik mit dem Partei-Ausschluss Schröders entsorgen will, nicht auch seine Verdienste gleich mit entsorgen? Wie würde das denn aussehen, wenn man den Urheber der ersten Vollbeschäftigungsphase nach der Deutschen Einheit, aus der SPD ausschließen würde? Wollen wir uns auch gleich davon distanzieren, von der Verweigerung des Irakkrieges gleich mit.
Man kann sich nicht mit einem Ausschluss von einem politischen Fehler befreien. Geschichte kann man nicht entsorgen. Man muss sie aufarbeiten. Man kann sich von eigener Verantwortung nicht dadurch befreien, indem sie einem Sündenbock aufhalst. Eine Partei, die Schröder ausschließt, macht sich lächerlich. Sie zeigt, dass sie die wichtigen Aspekte von Einzel- und Gesamtverantwortung nicht verstanden hat. Eine solche Partei dürfte in unserem Land nicht regieren.
Deshalb kann die gesamte Parteispitze der SPD absolut kein Interesse an einem Ausschluss Schröders haben.
Menschen haben nicht nur Verdienste. Und wenn sie sie haben, dann haben sie bestimmt auch immer Fehler. Und es ist wichtig, sowohl die Verdienste als auch die Fehler sachgerecht zu beleuchten, um zu verstehen, wie sie zustande kamen. Von beidem lässt sich lernen.
Wir können zu unserer Geschichte stehen. Und wir müssen das auch. Zu ihren Erfolgen, und zu ihren Abgründen. Aber entsorgen können wir unsere Geschichte nicht.
Deshalb: lasst Schröder in der SPD. Es kommen auch wieder andere Zeiten, da wird gerechter über ihn geurteilt als in der gegenwärtigen Hysterie.
Do
19
Mai
2022
Insgesamt 1085,10 € an Spendensumme Noch einmal 600 € dazu gekommen per Direktüberweisung

Das Benefizkonzert am 7. Mai 2022 hat insgesamt 1085,10 € an Spenden für die Ukraine - Hilfe erbracht.
Dieses Geld wurde einer örtlichen Initiative aus dem Elbe-Elster-Kreis, getragen vom Förderverein des Technischen Denkmals "Brikettfabrik Louise" in Domsdorf, nahe Bad Liebenwerda übergeben. Die Delegation aus Domsdorf, Uebigau und Wahrenbrück konnte direkt aus dem Konzert 485,10 €, die von den anwesenden Konzertgästen gespendet wurden, mit nach Hause nehmen. Die nun zu Buche schlagenden zusätzlichen 600 € wurden auf das Spendenkonto direkt im Zusammenhang mit dem Konzert am 7. Mai überwiesen.
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern:
Für jeden, der weiter gerne spenden will, hier noch einmal die Kontoverbindung:

So
20
Mär
2022
Was kommt auf uns zu? Was bedeutet der russische Feldzug gegen die Ukraine? Was müssen wir aushalten und was müssen unsere Ziele in diesem Konflikt sein?
Letzte Woche hat bekanntlich der ukrainische Präsident im Plenum des Bundestages gesprochen. Das, was eigentlich ein Symbol der Solidarität mit der von Russland heimgesuchten Ukraine hätte sein können, wurde bereits im Vorfeld skandalisiert; nicht wegen der Rede als solcher, sondern wegen der Weigerung der Ampel-Koalitionäre im unmittelbaren Anschluss an diese Rede dem Wunsch der Opposition zu folgen, und eine parlamentarische Aussprache über den Ukrainekrieg und was er für uns bedeutet zu führen.
Die Inszenierung dieses Skandals hat der Opposition, vor allem der Union einen Punktsieg beschert. Und zwar nicht deshalb, weil sie nicht auch ihre Mitverantwortung für den Überfall Russlands auf sein größtes Nachbarland tragen würde, sondern weil vor der deutschen Öffentlichkeit sichtbar, die Parteien der Koalition sich offenbar nicht in der Lage sehen, sich einerseits zu den Fehlern der Russlandpolitik der beiden letzten Jahrzehnte zu bekennen, als auch klar zu benennen, was dieser Krieg, den Russland vom Zaum gebrochen hat, für uns bedeutet, was neben den schrecklichen Kriegs-Bildern in der Ukraine selbst und mit den großen Flüchtlingstrecks aus der Ukraine durch die deutschen Bahnhöfe und Städte noch auf uns zukommen wird, was wir auszuhalten haben und welche Ziele wir, die Bundesrepublik im speziellen und die westlichen Demokratien im allgemeinen in diesem Konflikt verfolgen sollten, verfolgen müssen.
Ich will diese Verantwortung benennen, ich will versuchen anzudeuten, was der Ukraine-Konflikt für uns bedeutet, worauf wir uns einzustellen haben, und welche politischen Ziele wir in diesem Konflikt verfolgen müssen. Ich kann das nicht in gebotener Ausführlichkeit machen, ich kann hier nur skizzieren, was meiner Meinung nach jetzt ersichtlich und geboten ist.
Es war das Ergebnis einer deutschen Energiepolitik, dass Deutschland gegenüber Russland in den letzten beiden Jahrzehnten einen Sonderweg ging, und dass es sich im Ergebnis in eine eklatante Abhängigkeit gegenüber den russischen Energielieferungen begeben hat. Damit hatte es sich nicht nur über die europäische Energiestrategie hinweggesetzt, sondern sich auch gleichzeitig einer diplomatisch höchst ungewöhnlichen heftigen, offenen und öffentlich vorgetragenen Kritik unserer Partnerländer wie Frankreich und Großbritannien aber auch den USA ausgesetzt. Dabei darf man die US-amerikanische Kritik nicht nur der unseligen Trump-Administration zurechnen, auch der vergleichsweise besonnen und diplomatisch agierende Joe Biden sparte nicht mit Kritik an der Sache selbst.
Deutschland verbrämte diese schädliche deutsche Energiepolitik als eine besonders weise Form von Geopolitik gegenüber Russland, das man auf diese Weise in politisch in die westlichen Wirtschaftsstrukturen einbinden wollte, um so seine, immer erkennbarer werdende Rückkehr zu altem russischem Expansionsdrang zu entschärfen. Es ist schlicht das Gegenteil eingetreten. Dabei muss man der Fairness halber festhalten, dass keine nennenswerte deutsche Partei bis in die jüngste Vergangenheit hinein die fatalen Folgen dieser Energiepolitik korrigieren wollte. Das hat erst der russische Überfall auf die Ukraine bewirkt.
Deutschland hat damit Putin in seinem Glauben gestärkt, seiner expansionistische Politik gegenüber seinen europäischen Nachbarn ungestraft folgen zu können, und trägt damit eine Mitverantwortung für den russischen Überfall auf die Ukraine. Das ist schlimm, und das müssen wir uns vorhalten lassen. Insbesondere vom ukrainischen Präsidenten und wohl auch vom ukrainischen Boschafter, obwohl der gerne eher als Polemiker denn als Diplomat durch die Lande zieht.
Daneben hat Deutschland mit seiner Energie- und Russland-Politik aber auch den Zusammenhalt der Europäischen Union und der NATO einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Natürlich ist das Verhalten der Polen oder der Ungarn, was deren Rechtsstaatlichkeit angeht unverzeihlich, aber die Frage ist doch erlaubt, ob Deutschland, das ja die führende Macht in der EU ist, mit seinem egoistischen und geopolitisch blindem Kurs den zentrifugalen Kräften in der EU nicht Vorschub geleistet hat.
Jetzt tobt der Krieg in der Ukraine, und niemand weiß, wie lange er dauern wird. Es muss unser erstes Ziel sein, ihn nicht weiter eskalieren zu lassen. Aber in der Hand haben wir das nur z.T.. Und wir müssen der Ukraine als Staat und als Gesellschaft zur Seite stehen. Wir müssen das maximal mögliche leisten, um den Widerstandswillen der Ukrainer und der Ukraine selbst zu unterstützen. Das schließt selbstverständlich Waffenlieferungen mit ein. Bis wohin diese der Verteidigung der Ukraine dienen, oder ab wann sie eine Eskalierung des Krieges bedeuten, ist eine ganz schwere Frage, deren abschließende Beurteilung ich nicht leisten kann.
Dabei besteht die Gefahr einer Eskalierung nur zum Teil in der Einbeziehung anderer Länder, wie Polen, Rumänien, oder Staaten des Baltikums. Schlimmer fast noch ist der Einsatz von Atomwaffen in diesem Krieg, denn das führt mindestens zur Vernichtung Europas selbstverständlich unter Einschluss Russlands. Und das ist auch der Grund für die früh erklärte Nichtteilnahme der USA, oder den anderen Ländern der NATO an diesem Krieg. Denn wenn das passiert, dann haben wir nicht nur den 3. Weltkrieg, wie Biden nicht müde wird, zu erklären. Vielmehr werden wir dann erleben, wie die militärische Logik, die nur Sieg oder Niederlage kennt, auch vor dem letzten militärischen Instrument, dem Einsatz von Atomwaffen nicht zurückschrecken kann. Und dann wird es nicht bei einem einmaligen Einsatz bleiben, dann gibt es einen Atomkrieg. Diese Einsicht in die militärische Logik war es, die uns zu Zeiten des Kalten Krieges vor einem heißen direkten Krieg der Supermächte bewahrt hat. Und diese Logik ist es, die die NATO und die USA vor einer direkten Teilnahme am Ukraine-Konflikt warnen lässt, und die sie bisher vor der von Selenskiy geforderten Sperrung des ukrainischen Luftraums hat zurückschrecken lassen. Das ist weise und vernünftig.
Gleichzeitig hat niemand Einfluss auf die Wahl der militärischen Mittel, die Putin in seinem Feldzug gegen die Ukraine noch einzusetzen gedenkt. Terror gegen die ukrainische Bevölkerung kann er ohne Ende ausüben. Und dabei ist es durchaus möglich, dass er auf B und C – Waffen zurückgreifen wird. So hart das ist, und so schwer es sein wird, dabei zu sehen zu müssen. Der Einsatz von Atomwaffen seitens der russischen Armee wäre schlimmer. Denn dann hat die Zerstörung Europas begonnen, begonnen von Seiten Russlands. Dann sind alle Dämme gebrochen. Und dann würde ich nicht mehr die Hand dafür ins Feuer legen, dass die westeuropäischen Mächte sich weiter in militärischer Zurückhaltung üben werden. Besser wird dadurch nichts. Danach hätten wir dann eine neue Zeitrechnung, beginnend mit dem Jahr 1 nach dem ersten Atomkrieg. Wie das aussieht, will ich mir gar nicht ausmalen.
Und das alles macht die Aggressivität des neu entfachten russischen Expansionsdranges unter Putin aus: das ist ja nicht nur ein Angriff auf den Freiheitswillen, und dem Wunsch nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Ukrainer, sondern aller Menschen die sich mit diesem Wunsch der Ukrainer einig fühlen, ganz gleich ob sie im westlicheren Europa leben, oder auf allen anderen Kontinenten dieser Welt, ganz gleich, ob sie bereits in rechtsstaatlichen Demokratien leben, oder derzeit noch davon träumen müssen. Wie sehr muss Putin diese unsere Lebensweise hassen müssen, dass er nicht mal vor der Gefahr eines Atomkriegs zurückschreckt, um die Menschen von der Idee der Demokratie abzubringen?
Doch das wird ihm nicht gelingen. Denn die Politik von Putin, wie aller Autokraten und Diktatoren steht gegen den Lauf der Geschichte. Unsere Welt, die Menschheit selbst hat keine andere Möglichkeit um sich ihre Zukunft zu gestalten, um den Frieden zu bewahren, als den Weg der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Demokratie, der Kooperation und der Zusammenarbeit aller Länder und Völker zu gehen. Mit Unterdrückung, mit Unterjochung, mit Gewalt und Krieg lösen wir unsere Probleme nicht. Wir brauchen den Frieden und genau deshalb brauchen wir die Selbstbestimmung der Länder. Putins Krieg ist ein Anschlag auf uns alle.
Und genau deshalb ist es gerechtfertigt, mit allen anderen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, Russland von der Fortsetzung seines militärischen Feldzuges gegen die Ukraine abzubringen. Direkt eingreifen können wir nicht. Aber wir können die russische Infrastruktur treffen, die diesen Krieg erst möglich gemacht hat, wir können die Finanzströme unterbrechen, die das russische Militär finanziert, und die die russische Aufrüstung ermöglicht hat, wir können bis dahin gehen, den russischen Staat bankrottgehen zu lassen, der diese aggressive Politik ersonnen und durchgesetzt hat. Wir können den Technologietransfer unterbrechen, der die teuflischen russischen Waffen ermöglicht hat.
Putin hat diese westliche Sanktionspolitik einen wirtschaftlichen Blitzkrieg genannt. Damit knüpft er an die russischen Erfahrungen des deutschen Überfalls im 2. Weltkrieg an, den die damalige Sowjetunion siegreich beenden konnte. Doch Putin sollte nicht vergessen, dass es nicht die Sowjetunion allein war, die Hitlerdeutschland überwunden hat, sondern es war die Allianz der Alliierten selbst, das gemeinsame Zusammenstehen der Sowjetunion, den USA und Großbritannien gegen das aggressive Deutschland, das ganz alleine gegen diese alliierte Übermacht stand. Heute befindet sich Russland in der Rolle Hitlerdeutschlands. Das Menetekel des Blitzkrieges gilt nicht dem Westen oder der Ukraine, es gilt ihm, Putin selbst. Er wollte mit einem kurzen schnellen Feldzug die Ukraine erledigen. Er wird erleben, dass er wie seinerzeit Hitler mit diesem Überfall seinen eigenen Untergang eingeleitet hat.
Und trotzdem ist es nicht die Sache des Westens Putin zu stürzen. Das werden andere machen. Die Sache des Westens ist es, Russland dem Boden für seine weiteren militärischen Bemühungen zu entziehen, und zwar so lange, bis sich Russland komplett aus der Ukraine zurückgezogen hat, einschließlich der Krim und des Donbass. Einem Aggressor wie Russland gegenüber darf man keine Zugeständnisse machen, auch nicht die einer Neutralität der Ukraine.
Der letzte Punkt, den es zu bedenken gilt, das ist die künftige Erweiterung der europäischen Friedensordnung um Russland selbst, ohne Zugeständnisse, sondern einzig und allein auf dem Boden der Charta von Paris. Ein Russland, dass sich zu demokratischen Werten, zu den Prinzipien von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bekennt, ein solches Russland wird für seine Bürger und den Rest der Welt ein Segen sein. Mit einem solchen Russland wird der Westen wieder Frieden schließen können, und davor bräuchten Ländern wie Polen, das Baltikum oder die Ukraine dann auch keine Angst mehr zu haben. Ein solches Russland, das kann in die EU oder gegebenenfalls sogar in die NATO aufgenommen werden. Damit wäre das Kapitel des russischen Expansionsdranges beendet, und es könnte ein neues europäisches Kapitel aufgeschlagen werden. Aber bis dahin ist der Weg noch weit. Aber vorbereitet sein darauf, und es selber aktiv vorbereiten, das können und sollten wir jetzt schon.
Di
01
Mär
2022
Jetzt an einer gesamteuropäischen Friedensordnung arbeiten
Über den Tag hinausdenken
Moralisch hatte Putin seinen Ukraine-Krieg bereits verloren, bevor er ihn begonnen hat.
Es kann sein, dass sein Ukraine-Feldzug der Anfang von seinem Ende ist. Vorhersagen lässt sich das allerdings nicht.
Fakt ist, dass Putin in seinem Russland schon vorher mit dem Rücken an der Wand stand. Außer Säbelrasseln oder dem Mobilisieren russisch-nationalistischer Gefühle hat er seinen Bürgern ja nichts mehr anzubieten. Das ist einer der Gründe seiner militärischen Abenteuer. Aber jetzt ist es gut möglich, dass er in der Ukraine auch ein militärisches Fiasko erlebt. Doch ausgemacht ist das nicht. Trotz westlicher Sanktionen, trotz der überwältigenden Welle westlicher Solidarität, und vor allem trotz der tapferen und mutigen Gegenwehr der Ukrainer selbst. Es kann dennoch sein, dass Putin seinen Krieg gewinnt, und die Ukraine unterjocht. Aber er wird keine Freude daran finden. Er wird mehr Probleme damit haben, als vorher, und er bekommt mehrere unlösbare Probleme mit hinzu. Zunehmende wirtschaftliche Probleme werden zu sozialen Spannungen führen, die militärische Hochrüstung wird die nationalen Reserven verschlingen. Und eine stagnierende, ja schwindende Wirtschaftskraft wird von der Bevölkerung mit sinkendem Lebensstandard bezahlt werden.
Es ist klar, dass Putin sein Volk mit seinem Ukraine-Feldzug mit in seinen eigenen Untergang, sei es moralisch, sei es militärisch mit hineinzieht. Das ist jetzt schon so. Und das wird auch so gesehen von den eigenen Landsleuten. Sonst würden diese nicht so zahlreich gegen diesen Krieg demonstrieren.
Putin darf es nicht schaffen mit seinem Ukraine-Feldzug, der ja auch uns allen, den Staaten der EU, den Staaten, die sich auf dem demokratischen Weg befinden, dem Weg der Menschenrechte, des Rechts und der Gewaltenteilung befinden, gilt, die Grundfesten unserer europäischen Friedensordnung zu zerstören.
Die Grundprinzipien dieser Ordnung, wie sie in Helsinki vertraglich vereinbart wurden, wie sie zum Ende des Kalten Krieges völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben wurden, und wie sie auch bilateral zwischen der Ukraine und Russland vereinbart wurden, sind und bleiben richtig. Dass Putin sie aufkündigt, macht sie nicht falsch, und zerstört sie nicht. Putin allein wollte sich nicht mehr daranhalten. Der Westen konnte ihn nicht daran hindern, obwohl er sich dafür bis zum Schluss Mühe gegeben hat. An ihm liegt der Bruch des Völkerrechts, wie ihn Putin nicht erst jetzt, sondern seit vielen Jahren mehrere Male unter Beweis gestellt hat, nicht. Im Gegenteil; diese Grundprinzipien sind die einzige Möglichkeit für uns, ein Europa des Friedens zu Ende zu bauen. Und im Westen, in der EU, sogar in der NATO funktioniert das ja auch, trotz Türkei, trotz Polen und Ungarn.
Die europäische Zivilisation kann nur leben, wenn sie der Freiheit verpflichtet bleibt. Die europäische Freiheit wird in der Ukraine militärisch angegriffen. Wir Europäer sind solidarisch an der Seite der Ukraine, weil die Freiheit dort nicht untergehen darf. Aber wir dürfen auch nicht aufhören, an der europäischen Friedensordnung weiter zu bauen, damit sie auch in Osteuropa ihre segensreiche Wirkung entfalten kann.
Doch einen Automatismus, dass, wenn Putin untergeht, automatisch eine neue Friedensordnung entsteht, gibt es nicht. Wenn es auch nicht ausgeschlossen scheint.
Ich denke mir, dass wir uns, die EU, auch Amerika und generell die westlichen Staaten sich überlegen müssen, ob sich Russland nicht in eine gesamteuropäische Friedensordnung integrieren lässt. Das ist bisher, nicht zuletzt an Russland selbst, gescheitert, aber nicht nur. Es ist auch an den Amerikanern, und vielleicht sogar allen drei westlichen Siegermächten des 2. Weltkrieges gescheitert, und zwar 1990, als Gorbatschow den Kalten Krieg beendete.
Drei Mal hat Gorbatschow dem US-amerikanischen Präsidenten Bush Senior seinerzeit den NATO-Beitritt der Sowjetunion angeboten. Gorbatschow selbst wollte die Auflösung der Blöcke, sowohl des Warschauer Paktes wie auch der NATO. Letzteres hat Bush immer abgelehnt, weil er Deutschland in der NATO halten wollte, und weil er einer neuen Sicherheitsstruktur, die Gorbatschow das Europäische Haus nannte, und die damals nur als Vision existierte, nicht vertraut hat. Das Angebot von Gorbatschow, der NATO beizutreten war eine logische Reaktion auf diese Haltung der Amerikaner. Bush hat dieses Angebot, von dem Rice und Zoellick eindrucksvoll in "Sternstunden der Diplomatie" berichten, nie ausgelotet.
Die Folge davon war, dass Russland nicht in gemeinsamen Sicherheitsstrukturen verankert wurde. Das Wiederaufnehmen des russischen Expansionsdrangs und seiner Großmachtsphantasien, muss nun eben auch als eine Folge der Nicht-Integration Russlands in eine gemeinsame Sicherheitsstruktur gesehen werden.
Es wird Zeit für den Westen, wenn er denn die kleinen osteuropäischen Länder vor dem Expansionsdrang Russlands schützen will, und eine dauerhafte europäische Friedensordnung schaffen will, auszuloten, wie in diese Russland integriert werden kann. Eine mögliche Niederlage Russlands in der Ukraine, die wie häufig in der russischen Geschichte in einen wirtschaftlichen und sozialen Niedergang des großen russischen Volkes münden mag, was wir ihm nicht wünschen wollen, kann vielleicht ein Umdenken befördern. Aber auch so muss uns daran gelegen sein, die alte Vision von Gorbatschow von einem gemeinsamen europäischen Haus, ganz gleich in welcher Form, ganz gleich unter welchem Namen, zu verwirklichen. Unsere jetzige Friedensordnung bleibt unvollständig, solange es nicht gelingt, Russland als einen gleichberechtigten und ebenbürtigen Partner zu integrieren und mit ihm gemeinsam die europäische Friedensordnung zu vervollständigen.
Ja, wenn es einen Weg nach vorn mit Russland gibt, dann ist an die Überlegungen von Michail Gorbatschow anzuknüpfen. Sein Entwurf eines gemeinsamen europäischen Hauses war der richtige Schritt, der nur teilweise konstruktiv beantwortet wurde. Und ja: die Grundakte von Helsinki ist und bleibt der konstruktive Beginn einer gesamteuropäischen Friedensordnung.
Es wird darum gehen, in der Post-Putin Zeit neu daran anzuknüpfen und jede Form des Triumpfs zurückzuweisen. Denn es bleibt richtig: Europa (und die Welt) braucht verlässliche Verbindlichkeiten, die aus dem Wissen entstehen, dass Sicherheit nur gemeinsam gedacht werden kann. Insofern muss Russland wieder, wie unter Gorbatschow, zu einem Sicherheitspartner werden – je früher, desto besser. In der Charta von Paris sind diese Grundprinzipien enthalten. Es geht jetzt darum sie in gemeinsame Sicherheitsstrukturen münden zu lassen.
Als der erste Weltkrieg tobte, haben sich einige Politiker auf den Weg gemacht, und überlegt, welche Strukturen es braucht, um so einen Krieg in der Zukunft zu verhindern. Als der zweite Weltkrieg tobte, sind diese Überlegungen vertieft und nach 1945 realisiert worden. Vor einer ähnlichen Aufgabe stehen wir heute in Bezug auf das östliche Europa und vor allem von Russland.
Es braucht dafür den guten Willen von beiden Seiten. Den von Putin sehe ich nicht. Und damit braucht man wohl auch nicht zu rechnen. Aber das sollte uns nicht daran hindern, an einer Friedensarchitektur zu arbeiten, die auch in Osteuropa den Frieden schützt. Und wenn andere das für illusorisch halten, und sich daran nicht beteiligen wollen, ist das noch lange kein Grund für uns, nicht unsererseits für einen dauerhaften Frieden, um und mit Russland zu arbeiten.
Inspiriert und entstanden aus einer Korrespondenz mit Gert Weißkirchen, MdB a.D..
Mi
18
Nov
2020
Der du die Missetat der Väter heimsuchest auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. (2. Mose 34,7)
Vertreibung Odsun Das Sudetenland
(Doku Arte, Montagnacht, 17.11.20)
Gestern Abend ist mir beim Anschauen der ARTE-Doku „Vertreibung“ der Hintergrund der Beneš-Dekrete mit denen die deutsche Bevölkerung nach dem 2. Weltkrieg aus dem Sudetenland vertrieben wurde, klar geworden.
Vorgeschichte
Beneš war der Chef der tschechischen Exilregierung in London, die hier nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag 1939 Unterschlupf gefunden hatte. War die deutsche Besetzung des Sudetenlandes 1938 noch durch das Münchener Abkommen quasi völkerrechtlich abgesegnet, so galt das für den Einmarsch der Deutschen in das restliche Gebiet der Tschechoslowakischen Republik, bzw. in jene Teile der Tschechoslowakei, die nach dem Einmarsch von Polen und Ungarn 1938 und der Abspaltung der Slowakei noch übriggeblieben waren, nicht mehr.
Der Henker von Prag
Deutschland wandelte diese Gebiete in sein Protektorat Böhmen und Mähren um, mit dem Ziel, es endgültig dem Territorium des Deutschen Reiches zuzuschlagen. Im Oktober wurde Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und Organisator der Judenvernichtung Reichsprotektor auf der Prager Burg und begann sofort offen nationalsozialistischen Terror gegen die tschechische Bevölkerung auszuüben. Er errichtete nicht nur mit Theresienstadt das erste Konzentrationslager auf tschechischem Boden, sondern gliederte auch die tschechische Wirtschaft in die deutsche Kriegswirtschaft ein, und machte die Arbeiter damit zu Zwangsarbeitern für das Deutsche Reich, sondern er begegnete auch jeder Form von tatsächlichem oder vermuteten Widerstand mit brutaler, totalitärer Härte. Binnen kurzem verhaftete er in einer ersten Welle 6000 Tschechen und ließ 1200 Todesurteile verhängen und ausführen, (was ihm den tschechischen Spitznamen „Henker von Prag“ eintrug). Der Rest kam in KZ’s; nur etwas über 50 Tschechen überlebten. (Wikipedia).
ARTE sprach auch davon, dass Heydrich einen Plan zur Ausmerzung der tschechischen Bevölkerung und Kultur nach Prag mitgebracht hatte, den er nach dem Ende des Krieges zu realisieren gedachte.
Unter diesen Bedingungen dürfte es nicht schwer gewesen sein, von London aus ein Attentat (Mai 1942) gegen Heydrich organisieren zu lassen, an dessen Folgen er dann verstarb (Juni 1942). Die Rache der Deutschen war furchtbar. Lidice ist ihr Symbol, aber es ist nicht das einzige Dorf, das die Deutschen Besatzer ausrotteten. Hitler liess das Standrecht über das gesamte Böhmen und Mähren ausrufen. Es gab Verhaftungen und Massenerschiessungen.
Die Beneš-Dekrete
Und Edvard Beneš im fernen London schwor Rache. In ihm reifte die Idee einer Art Endlösung der deutschen Frage auf dem Staatsgebiet der tschechoslowakischen Republik. Die realisierte er dann unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Prag 1945, in dem er die sogenannten Beneš-Dekrete unterzeichnete, die die Entrechtung und Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung anwies.
Der Rest ist bekannt, und wird auch heute noch im Volksmund erzählt. Die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei war ein schlimmes Unrecht, das wie alles Unrecht kein Problem löst, sondern neue schafft. Dabei war Beneš kein Kommunist, er war vielleicht Nationalist, und sein Handeln lässt völkisches Denken erkennen, genauso wie das seiner Feinde.
Vertreibung aktuell
Umsiedlungen ganzer Bevölkerungen waren damals an der Tagesordnung und grundsätzlich immer mit schweren Verbrechen verbunden. Sie wurden nicht nur von den Kommunisten unter Stalin ausgeübt, oder von den Nationalsozialisten, sondern z.B. von den Briten, von den Osmanen gegen die Armenier oder Griechen ganz zu schweigen.
Diese Art der Lösung politischer Probleme ist auch heute noch nicht aus den Köpfen manch eines Herrschers oder Partei. Der letzte Vertreibungswelle in Europa ist mit dem Namen Milosevic in Serbien verbunden, und noch nicht so lange her. Und gerade erst sind wir Zeugen eines weiteren Exodus, der Armenier aus Berg Karabach.
Die Sudetendeutschen, die von Beneš und Tschechen aus ihrem Staatsgebiet vertrieben wurden, wurden dadurch einer ganz eigenen Leidensgeschichte überantwortet, die auch von ihren Kindern und Kindeskindern zu tragen war und vielleicht noch immer ist. Doch das Unrecht, das in ihrem Namen, wie im Namen aller Deutschen vorher an der tschechischen Bevölkerung ausgeübt wurde, die „Heim ins Reich“-Rufe und die starke Anhängerschaft der NSDAP innerhalb der sudetendeutschen Bevölkerung vor der Besetzung der Prager Burg, ging der Vertreibung voraus. Rache ist ein natürlicher Reflex für das Erleiden von Unrecht. Aber Rache ist eben auch eine der Ursachen für neues Unrecht.
Als Beneš 1942 Rache gegen die Deutschen schwor, war in Westeuropa bereits der Gedanke an Versöhnung und Zusammenarbeit einstmals befeindeter Staaten und Nationen geboren worden, womit der Nationalismus, der zum 1. Weltkrieg geführt hatte, überwunden werden sollte und nach 1945 schließlich auch konnte. Beneš war mit seinen Dekreten sicher nicht gut beraten, er stand nicht nur für das alte Denken von
Unrecht, Rache und Vergeltung, wodurch neues Unrecht geboren wird, er wird auch immer in einem Atemzug mit jener Vertreibungspolitik genannt werden, die damals entweder exekutiert oder auch akzeptiert und geduldet wurde.
Heute reicht es nicht aus, solche Art von Umsiedlungspolitik zu verdammen, und ihre Urheber zu brandmarken, im Gegenteil. Damit befindet man sich auch weiterhin nur im Jahrtausende alten Kreislauf von Unrecht, Vergeltung und neuem Unrecht.
Frieden wird nur dort geschaffen, wo Menschen und Staaten auf Partnerschaft setzen, auf ein gleichberechtigtes Miteinander über Ethnien, Religionen und Kulturen hinweg. Nur das macht uns reich, nur so können wir die innergesellschaftlichen aber auch internationalen Probleme lösen.
Mi
04
Nov
2020
Monika Maron zwischen Welten
Monika Maron wandert zwischen den Welten. Ganz unschuldig an der Entzweiung mit ihrem Verlag ist sie nicht. Offenbar war ihr die Tragweite ihrer Entscheidung ein Buch im Antaios – Verlag veröffentlichen zu lassen, auf ausdrücklichen Wunsch ihrer Freundin, einer Buchhändlerin in Dresden offenbar nicht.
Ich habe die Entscheidung des Fischer-Verlages, sich von Monika Maron zu trennen, bedauert. Das Buch „Flugasche“ mit der die Zusammenarbeit beider begann, 1981, noch zu DDR-Zeiten ist ein wertvolles Buch. Ich habe es gerne gelesen, wenn auch erst nach dem Zusammenbruch der DDR. Die spätstalinistischen Strukturen in einer ostdeutschen Zeitschriften-Redaktion, die typischen Ausgrenzungsphänomene der SED-Diktatur, das Zuziehen einer Schlinge, das im Buch mit Berufsverbot der Journalistin endet, das wird dort gut beschrieben. Es war klar, dass die SED die Veröffentlichung eines solchen Buches nicht zulassen konnte. Und es war auch klar, was mit der Autorin passieren würde, wenn sie dieses Buch stattdessen im renommierten Fischer-Verlag in Frankfurt am Main veröffentlichen lassen würde.
Monika Maron hat um die Veröffentlichung von „Flugasche“ in einem DDR-Verlag gekämpft. Doch das habe ich erst Jahre später erfahren, als es eine andere, ähnlich wellenschlagende Debatte um Monika Maron gab: 1995,

die Entdeckung ihrer Stasi-Akte. Sie war damals nicht die einzige prominente Person der Zeitgeschichte, der das widerfuhr, und wie manche andere auch, versuchte sie, die Problematik dieser Zusammenarbeit zu verharmlosen. Das gipfelte für mich in einem Namensartikel der FAZ vom 14. Oktober 95. Da gab sie an, dass die Zusammenarbeit nicht mal ein Jahr gedauert hätte, dass sie ausdrücklich niemanden geschadet hätte, ja dass sie gegenüber dem MfS sogar erklärt hätte, dass sie niemanden verpfeifen würde. Und sie geht ziemlich hart mit ihren Kritikern, darunter
Bärbel Bohley ins Gericht, die wohl gemeint hatte, dass die ganze Wahrheit ihrer Zusammenarbeit mit dem MfS in den Schnipsel-Säcken der zerrissenen Stasi-Akten lagere, und erst mit deren Rekonstruktion ans Tageslicht kommen würde.
Meine Sympathie galt damals Bärbel Bohley, die von Monika Maron geschmäht wurde, als eine jener typischen ostdeutschen Oppositionellen die von ihrem geliebten Lieblingsfeind nicht lassen könne, und vor deren Vorstellungen von Gerechtigkeit sie der Rechtsstaat schützen möge. Meine Sympathie gilt auch heute noch Bärbel Bohley. Denn auch ich hatte meine Fragen, die mich bis heute gegenüber derartigen Erklärungsmustern wie die von Monika Maron misstrauisch machen.
In meinen Augen waren Kontakte zur Stasi Tabu. Es gab bestimmte Sachen, die machte man einfach nicht in der DDR. Wer sich mit der Stasi einließ, der wusste, dass das die schlimmsten von allen sind. Eine Partnerschaft, gar aus eigenen, freien Stücken kam für mich dabei nicht in Frage. Für andere wohl schon. Aber wie die das anstellen wollten, dass sie für die Stasi dabei nicht zu einem willkommenen Helfer werden, das war mir immer schleierhaft. In dieser Bereitschaft zur Zusammenarbeit lag auch eine Respektierung, wenn nicht Anerkennung dieses ganzen diktatorischen Systems. Monika Maron arrangierte sich mit dem schlimmsten Unterdrückungsinstrument, das der SED zur Verfügung stand. In dem Moment als sie das tat, und die Akten offenbarten es wohl 1995, hatte sie eine rote Linie überschritten. Als Schriftstellerin war sie für mich damit erledigt. „Flugasche“ blieb das einzige Buch, das ich von Monika Maron gelesen habe.
In ihrem Namensartikel für die FAZ, in welchem sie für ihre Rechtfertigung das Prinzip des Angriffs als beste Verteidigung wählte, erwähnt sie, dass sie für die Veröffentlichung von „Flugasche“ sogar bei
Klaus Höpcke war, seinerzeit als Oberzensor der DDR gerade Kulturminister. Sie hatte einen Termin bekommen und wurde von ihm in seinem Büro, wahrscheinlich Molkenmarkt 1 in Ostberlin empfangen.
Noch heute frage ich mich, über welche Kontakte sie verfügt haben musste zu DDR-Zeiten. Die waren allererster Güte. Da mag sicher zu beigetragen haben, dass ihr
Vater, Karl Maron Innenminister der DDR war. Wie sehr sie sich hier zu Hause gefühlt hat, das weiss ich nicht. Aber dass es sich hier um die obere Ebene der Funktionärschicht handelt, das scheint mir offensichtlich zu sein.
Monika Maron hat das nicht daran gehindert, „Flugasche“ zu schreiben. Das ist ihr hoch anzurechnen. Auch mit ihrer Ausreise aus der DDR 1988 vollzieht sie einen Bruch. Doch wie vollständig ist dieser Bruch? Hat sie die Problematik der SED-Diktatur über „Flugasche“ hinaus durchschaut? Haben sich ihre familiären Loyalitäten auch auf die politischen ausgewirkt?
Und auch ihre Loyalität zu ihrer Freundin in diesem Dresdner Buchladen, der zuliebe sie ihren Essayband in der Reihe "Exil" veröffentlicht hat, sehe ich mit anderen Augen. Auch hier hat sie eine Grenze überschritten. Das macht "Flugasche" nicht zu einem schlechten Buch. Aber nachahmenswert ist das nicht. Ich finde nämlich, dass man Institutionen wie dem Antaios-Verlag nicht dabei helfen sollte, rassistische, völkische eben auch neonazistische Positionen in der Mitte der Gesellschaft wieder hoffähig zu machen.
Man kann nicht einfach zwischen den verschiedenen Sphären des eigenen Lebens hin und her changieren, ohne Klarheit zu schaffen, und die notwendigen Trennstriche zu ziehen. Man darf sicher nicht die persönlichen Beziehungen den politischen unterordnen, umgekehrt aber darf man auch wegen persönlicher Rücksichtnahmen in politischen Fragen Unklarheiten aufkommen lassen, insbesondere wenn wie bei Monika Maron, man eine Person der Öffentlichkeit ist. Es gibt Situationen, da kann man sich nicht um die notwendige Auseinandersetzung drücken. Die muss nicht mit einem persönlichem Bruch enden. Im Gegenteil, gerade funktionierende persönliche, private Beziehungen leben von der Offenheit und der Ehrlichkeit einander gegenüber.
Monika Maron hat es ihr Leben lang in die Öffentlichkeit gedrängt. Dabei war ihr um provokante Debatten nicht verlegen. Aber man muss seine Positionen nicht nur offenlegen, sondern auch stringent zu Ende denken, man muss sie vor allem vom Ende her bedenken. Das aber hat sie nicht gemacht. So blieb sie einerseits dem DDR-System verhaftet, von dem sie sich doch distanzieren wollte. Und nun steckt sie in dem neurechten Sumpf, deren Thesen sie sich erklärtermaßen doch nach eigener Überzeugung nicht zu eigen machen will. So kann man auch noch mit 80 daran arbeiten, systematisch seinen eigenen Ruf zu ruinieren.
Di
20
Okt
2020
Nachhaltige Lernergebnisse beim Klavier-Üben durch Wiederholen

Das Lernen umfasst viele Aspekte. Einer davon ist das Verstetigen von Lernerfolgen. Denn nicht selten werden Schwierigkeiten zwar bewältigt, und Lernerfolge stellen sich ein. Doch beim nächsten Üben sind sie wieder verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt, und man muss von vorne beginnen. Das ist frustrierend, und macht schlechte Laune. Aber es muss nicht sein. Lernergebnisse lassen sich relativ einfach verstetigen, wenn man die richtigen Wiederholungsintervalle wählt.
Denn die Wiederholung ist die Mutter des Wissens. Das gilt auch fürs Klavierüben. Dabei ist es wichtig, dass man die richtigen Wiederholungsintervalle wählt. Dann ist es ein Kinderspiel.
Hat man also ein neues Stück einstudiert, oder eine spezifische Schwierigkeit studiert, oder aber, was sehr häufig vorkommt, eigentlich die Regel ist, einen kleinen Abschnitt davon, so sollte man das kurz danach wiederholen. Zuerst wählt der Übende also ein kurzes Intervall, sagen wir eine Stunde bis zur ersten Wiederholung. Danach verdoppelt man dieses Intervall, kann also zwei Stunden lang etwas anderes machen. Jetzt erfolgt die zweite Wiederholung. Die Dritte nach vier Stunden Pause. Und dann erst wieder am nächsten Tag. Danach legt man einen Tag Pause ein, bevor die nächste Wiederholung an der Reihe ist. Und nun werden die anstehenden Pausen auch wieder verdoppelt, so dass man 2 Tage warten kann, dann 4 Tage, dann 8 Tage, und zu guter Letzt 2 Wochen. Das müsste reichen. Wer will, kann einen Monat später noch mal eine Wiederholung starten. Es schadet nichts. Nun müsste das Stück, oder ein einzelner Abschnitt recht gut im Gedächtnis verankert sein, und leicht wieder abzurufen.
Wer sich auf diesen Prozess einlässt, wird schnell merken, dass der Aufwand schon bei der ersten Wiederholung nicht mehr ganz so gross ist. Bei der zweiten und dritten deutlich reduziert, und erst recht bei den jeweils nächsten. Allerdings ist es nicht so, dass man bei den einzelnen Wiederholungen komplett fehlerfrei spielt. Denn ein bisschen was geht in der Wartezeit von Wiederholung zu Wiederholung immer verloren. Deshalb muss man sich auch bei den Wiederholungen genauso konzentrieren, wie am Anfang. Und natürlich muss bei jeder Wiederholung wieder der gleiche Massstab angelegt werden: Fehler müssen bearbeitet und in Ordnung gebracht werden. Es gibt keine bessere Methode, zur Erzielung dauerhafter und vor allem nachhaltiger Lernerfolge.
So einfach ist das Ganze.
Etwas Theorie
Das dahinter liegende Geheimnis ist die Merkfähigkeit unseres Gehirns. Das unterscheidet bekanntlich zwischen Arbeits- und Langzeitgedächtnis. Stellt man sich, also seinem Gehirn eine neue Aufgabe, so wird das Arbeitsgedächtnis voll in Anspruch genommen. Das ist zuverlässig und behält, solange es nicht überfordert wird, alle wichtigen Informationen, die zur Bewältigung der Aufgabe notwendig sind.
Doch sobald die Aufgabe beendet wird, und man sich neuen Tätigkeiten zuwendet, beginnt der Wissensschwund des Gedächtnisses. Klar, das Wissen ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Im Langzeitgedächtnis sitzt es noch nicht. Das Arbeitsgedächtnis bereitet sich auf neue Aufgaben vor. Doch dieser Vorgang des Vergessens, oder besser Verschwindens weil unnütz, geschieht nicht schlagartig, und nicht mit einem Mal. Sondern in Form eine Hyperbel, also zuerst schnell, dann langsamer, bis so gut wie nichts mehr übrig bleibt. Wie lange dieser Vergessensvorgang dauert, kann ich nicht sagen. Doch kann man schon ein paar Stunden später feststellen, dass vielleicht nur noch die Hälfte da ist. Am nächsten Tag vielleicht noch ein Drittel, manchmal nur ein Zehntel. Und noch später hat man das Gefühl, dass gar nichts mehr vorhanden ist. Das ist der Grund, weshalb dieser frustrierende Eindruck entsteht, als ob das ganze Erarbeitung eines neuen Stückes, oder einer Passage oder aber einer spezifischen technischen Schwierigkeit, die man gestern doch erfolgreich gelernt und gemeistert hat, komplett verschwunden scheint. Und man also komplett von vorne anfangen muss.
Um diese zu verhindern gibt es das Mittel der Wiederholung. Und die hat zwei Vorteile, gesetzt den Fall, man beginnt rechtzeitig mit dem Wiederholen. Rechtzeitig heisst in diesem Fall, dass man sich die Anfangsphase, in der noch recht viel im Gedächtnis verblieben ist, zunutze macht.
Gelingt einem das, und das dürfte kein Problem sein, so erzielt man zwei Effekte. Zum einen kann man ja auf das noch vorhandene Wissen, also Können aufbauen, zum anderen signalisiert man mit jeder Wiederholung dem eigenen Gehirn, dass man dieses Wissen nicht nur einmal zur Verfügung haben möchte, sondern dauerhaft. Und das führt dazu, dass nun das Langzeitgedächtnis aktiviert wird.
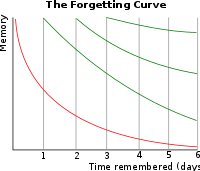
Und einen weiteren, wohl damit zusammenhängenden Effekt gibt es zu bewundern. Nach jeder neuen Wiederholung schwindet das Wissen zwar wieder aus dem Gedächtnis, aber deutlich langsamer, als nach den vorherigen Auffrischungsprozeduren. Das Wissen verstetigt sich also. Diesen Effekt hat der Psychologe Hermann Ebbinghaus, der Vater der kognitiv-psychologischen Forschung in der nebenstehenden Kurve festgehalten. Man sieht wie nach jedem Wiederholungsintervall die Hyperbel des Vergessens abflacht, das erworbene Wissen und Können also viel länger als vorher im Gedächtnis bleibt. Und daher können wir nun das Wiederholungsintervall verlängern. Gleichzeit verringert sich der Aufwand, mit dem das Wissen, resp. Können aufgefrischt werden muss.
Und die so gewonnene Zeit kann man nun nutzen, sich einen neuen Abschnitt, eine neue Schwierigkeit oder ein ganz neues Stück zu erarbeiten. Nach einer Weile wird man merken, dass dafür im Schnitt immer etwa ein Drittel der Übungszeit insgesamt zur Verfügung steht. Also zwei Drittel Wiederholung stehen einem Drittel Neueinstudierungsaufwand gegenüber.
Und was besonders beglückend ist, mit jeder Wiederholung lernt man sein Stück besser kennen, man spürt förmlich den Fortschritt und man spürt auch die wachsende Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Lernleistung lässt sich mit jeder Wiederholung leichter abrufen, zumindest in der Regel.
Abgrenzung
Sicher, dieses Wiederholungsregime ist nicht das Ganze. Aber es ist eine unverzichtbare Voraussetzung, um die eigenen Lernerfolge zu verstetigen. Das eigene Klavierspielen wird besser, belastbarer und nachhaltiger.
Dieses Wiederholungsregime leistet viel, aber nicht alles. Denn Konzentrieren muss man sich in jedem Fall, und das ist ein Thema für sich. Aber auch die Frage, wie gross der Abschnitt also die zu bewältigende Herausforderung sein darf, wird dadurch nicht gelöst. Und man weiss ja auch: so notwendig eine Zergliederung des Stückes ist, so unverzichtbar ist das Wiederzusammensetzen der einzelnen Abschnitt zu dem letztlich zu spielenden Ganzen. Und nach jedem einzelnen Zusammensetzen von Abschnitten muss man sich erneut in den Wiederholungsmodus begeben.
Sa
26
Sep
2020
Die Ost-CDU – nicht besser als die LINKEn? - Eine Entgegnung
"Die CDU hat sich bis heute mit keinem Deut mit der Vergangenheit ihrer von der SED finanzierten und stets linientreuen Schwesterpartei im sogenannten ‚Demokratischen Block‘ der DDR auseinandergesetzt. Es ist verlogen, den Linken Vorwürfe zu machen, wenn man selber nicht besser ist.“
Die DDR als „Unrechtsstaat“ zu bezeichnen, wie es in Richtung der Linken häufig gefordert wird, ist …. problematisch. …. dieser Begriff sei nicht klar. „Wenn man darunter versteht, dass ein Staat jederzeit ins Justizwesen eingreifen kann, dann ist die DDR ein Unrechtsstaat gewesen. Es war aber nicht alles Recht in der DDR Unrecht. Dann müssten wir alle Ehen auflösen, die in der DDR geschlossen wurden. Das wäre absurd.“
„Aber seither sind bald 30 Jahre vergangen. Inzwischen hat ein Generationswechsel stattgefunden, und die Jüngeren sind dementsprechend durch die Demokratie geprägt. Sie haben nichts mehr mit der SED zu tun.“

1.
Stimmt es denn, dass die CDU in Sachen Aufarbeitung nicht besser sei, als die LINKEn?
Zuerst muss man mal festhalten, dass die CDU und die SED zwar formal gleichrangige Mitglieder der Nationalen Front waren, aber die SED war Koch, und die CDU war Kellner.
Die Macht in der DDR hatte die SED. Sie war der Staathalter von Gnaden Moskaus. Sie lenkte die Geschicke der DDR. Zu Recht trägt der kommunistische Staat in der DDR ihren Namen, SED-Diktatur, die nach dem Motto
Ulbrichts: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben!“ gebildet wurde. Für die Kommunisten in der SBZ/DDR war es nur wichtig, dass die Fassade ihres Staates demokratisch aussah, im Kern war die DDR genauso wie alle anderen kommunistischen Staaten im Moskauer Einflussbereich, eine absolutistisch regierter Staat, in der eine kleine kommunistische Führungsschicht faktisch über die gesamte staatliche Macht schalten und walten konnte, wie es ihr richtig erschien.
Das demokratische Aussehen ihres Staates war der speziellen Demokratie-Geschichte Deutschlands geschuldet, die vor allem nach der Erfahrung der nationalsozialistischen Geschichte Hitlerdeutschlands, nach 1945 die einzige Perspektive für ein Deutschland bot, das dem Frieden nach innen und aussen verpflichtet sein sollte. Und deshalb liess Stalin ein Mehrparteiensystem in der SBZ zu, das aber sofort, als sich zeigte, dass die Kommunisten in demokratischen Wahlen untergingen, geschliffen wurde. Zuerst wurde die SPD beseitigt – durch ihre Zwangsvereinigung mit der KPD. Daraus ging die SED hervor. Damit war für die übrig gebliebenen, formal selbständigen Parteien klar, wo der Hammer hängt. Ein eigenständiges und selbstbestimmtes Parteileben hat die Ost-CDU seit 1946 nie gehabt.
Niemand anders als ihr 1. Parteivorsitzender Otto Nuschke hat das auf den Punkt gebracht, als er auf einem Parteitag in den 50er Jahren seinen Delegierten erklärte, dass der CDU nur die Wahl zwischen Kamikadse oder aber Mitgestaltung der SED-Diktatur habe. Kurz, um den Preis der Unterordnung und Preisgabe aller ihrer Werte und politischen Ziele, konnten die CDU-Mitglieder immerhin an den Futtertrögen der Macht mitschnuppern, in den kommunalen Parlamenten, in der Volkskammer und in den öffentlichen Verwaltungen. Die Ost-CDU hat sich angepasst, nie hat sie aufgemuckt. Von einer Möglichkeit politischer Veränderungen in der DDR hat sie nicht einmal geträumt, geschweige denn, dass sie Überlegungen für eine Zeit nach der sowjetischen Besatzung angestellt hätte. Immerhin bot sie für manch einen DDR-Bürger einen gewisse Zuflucht, wenn er sich durch seinen Eintritt in die CDU Schlimmeren, wie SED-Beitritt oder Kampfgruppen-Mitgliedschaft entziehen konnte.
Im Grunde war auch die CDU ein Opfer der SED-Alleinherrschaft. Allein, sie betrachtete ihren politischen Weg als Tugend. In Sachen Anpassung und Unterordnung unter die bestehenden machtpolitischen Tatsachen in der DDR war sie ein Vorbild. Und so wurde auch die Ost-CDU zum Repräsentanten der SED-Diktatur, in der DDR war sie ein Kollaborateur der Kommunisten und der sowjetischen Besatzungsmacht. Und so wurde sie zum Täter in Sachen SED-Diktatur. Aber eben einem untergeordneten, nachgeordneten, faktisch unbedeutenden Täter. Die Linie hat die SED vorgegeben. Die CDU ist nur hinterhergetrottet. Insofern kann man, mit Blick auf die DDR-Geschichte eben nicht sagen, dass die CDU keinen Deut besser gewesen sein, als die SED. Die SED war der Leithammel, die Ost-CDU gehörte zur Herde.
2.
So verschieden wie die DDR-Geschichte der beiden Parteien ist, so muss auch ihre Aufarbeitung sein. Beiden Parteien immerhin gemeinsam ist ihr Hineinstürzen in die friedliche Revolution 1989, von der sie überrascht wurden, obwohl beide wissen konnten, dass die Tage der sowjetischen Besatzungsmacht gezählt waren, ja, dass der oberste Kremlherrscher Gorbatschow selbst, beschlossen hatte, sein Reich auf eine neue Grundlage zu stellen, Gewaltlosigkeit und Selbstbestimmung. Weder SED noch Ost-CDU hatten das in ihrem Programm. Trotzdem wurden sie von den damaligen stürmischen Zeiten nicht hinweggefegt. Die CDU-Ost gelang sogar der Aufstieg in die Regierung, sie stellte den Ministerpräsidenten 1990. Und die SED kam für ihre Verhältnisse
mit einem achtbaren Ergebnis in die erste frei gewählte Volkskammer.
Bei ihr, die sich inzwischen (Dezember 89) in PDS umbenannt hatte, hat das mit Gysi und mit Modrow zu tun.
Bei der Ost-CDU mit Helmut Kohl. Modrow, der letzte SED-Ministerpräsident der DDR, gab den ehrlichen Makler des Übergangs, der sich der Demokratisierung der DDR nicht entgegenstellte und sich nur im Geheimen, sozusagen klandestin bemühte, soviel von Macht und Einfluss der alten SED-Nomenklatura in Verwaltung und Volkswirtschaft und in den bewaffneten Organen zu bewahren wie eben möglich war. Er gab der SED ein neues Gesicht; besser: er half ihr, das Gesicht zu bewahren.
Ein wirklich neues Gesicht war Gysi. Er gab den eloquenten Reformer, der die Vision des Sozialismus aus der Asche der untergehenden DDR neu empor steigen liess. Ein moderner, ein linker Sozialismus, ein europäischer, ein weltumspannender, antikapitalistischer sollte es sein. Beiden, Modrow und Gysi gelang es die anhaltende Erosion der Loyalitäten in der DDR-Bevölkerung gegenüber der alten SED aufzuhalten und zum Stoppen zu bringen. Wer hätte das gedacht? Aufarbeitung sieht anders aus. Da hätte man die Verbrechen benennen müssen, die im Namen des Kommunismus an den Menschen begangen wurden, und an denen die SED beteiligt war. Eine dürre Entschuldigung, einige wenige Rehabilitierungen in Ungnade gefallener Alt-Kommunisten. Das wars auch schon. Über die ganzen verheerenden Folgen kommunistischer Politik in Deutschland, angefangen 1918 mit Generalstreik und Aufständen gegen die erste deutsche Demokratie, den direkten und indirekten Hilfen für Machtergreifung der Nazis, dem Kapo-System in den NS-Konzentrationslagern, der Überantwortung und Ermordung deutscher Exilianten in das Stalinsche Gulagsystem, dem Aufbau einer bolschewistischen Diktatur in Deutschland, ihrem Terror- und Unrechtssystem, der Statthalter-Funktion der SED für die bolschewistische Besatzungsmacht, dem Zerstören der Volkswirtschaft, dem Bau der Mauer, den Unterdrückungsinstrumenten, dem MfS, etc. bis hin zum totalen Bankrott der SED und nicht zuletzt ihrer Weigerung Gorbatschow mit eigenen Reformen beizustehen, darüber viel von Seiten Gysis und Modrows kein Wort. Die ehemalige SED hat ihre Geschichte nicht aufgearbeitet, sie hat sie nicht einmal benannt. Sie versteht sich bis heute als Siegelbewahrerin eines sozialistischen Traums, von dem niemand wissen kann, wie sie ihn denn realisieren will.
Die Geschichte der Ost-CDU sieht anders aus. Sie ist das Paradebeispiel für die Hilflosigkeit breiter bürgerlicher Schichten in der SBZ/DDR gegenüber dem bolschewistischen System, seinem Druck und Zwang, seiner scheinbaren Alternativlosigkeit. Die CDU-Ost hat in der DDR einfach nur versucht, zu überleben. Dafür hat sie alles geopfert was ihr wichtig war, Programm, Vision und Werte. Zum Schluss wollte auch sie den Sozialismus und verriet ihre Vision der Wiedervereinigung genauso wie ihre Vorstellungen von Marktwirtschaft. Vom Festhalten an Rechtsstaat oder gar Menschenrechten ganz zu schweigen.
Doch in der Ost-CDU war das Wissen um die eigene Unterwerfung unter das Unrechtssystem der SED nie verloren gegangen. So jämmerlich auch manche der Funktionäre der Ost-CDU, bis in die Jahrzehnte der Nachwendezeit wirken mochten. Einen letzten Rest an Würde und an Selbstachtung hatten sie sich bewahren können. Gerade weil sie um ihre Unterwerfung wussten.
Und genau aus diesem Wissen heraus gelang ihnen im Herbst 1989 ein Neuanfang.
Unterstützt durch die alte Nomenklatura, von denen ihre Funktionäre ein Teil waren, und einigen Strategen des in die Defensive geratenen MfS gelang es de Maiziere, sich Helmut Kohl als adäquater Partner für seine Einheitsstrategie anzudienen. Und damit war die Zukunft der Ost-CDU und ihrer Funktionäre gesichert.
Vom Verrat an all den Werten, die sie nun ab 1989 hochhielten, Freiheit, Recht und Einigkeit, aus der Mitmachzeit der SED-Diktatur, von der Hilflosigkeit, von der vollständigen Kapitulation vor der Macht der SED, war nicht mehr die Rede. Mit der Volkskammerwahl 1990 wurde die Ost-CDU zur bestimmenden politischen Kraft in Ostdeutschland, die die deutsche Einheit organisierte. Sie fühlte sich durch die Wahlergebnisse rehabilitiert, ja sie triumphierte geradezu.
Wahlerfolge laden nicht zur Aufarbeitung ein. Ihren Wahlerfolg 1990 hat die CDU Helmut Kohl zu verdanken, und der breiten Unterstützung den dieser bei den damaligen DDR-Bürgern genoss. Das geringe intellektuelle Potential der Ost-CDU, der Mangel an Konzepten, die offenkundige Hilflosigkeit vieler ihrer Funktionäre, und die hier praktizierte Tugend der Anpassung ohne die politischen Verhältnisse zu hinterfragen hat die Erfolge dieser Partei an der Schwelle der 90er Jahre verblassen lassen.
Wenn man der Ost-CDU aus ihrer DDR-Geschichte etwas vorwerfen kann, dann ist das die vollständige Unterwerfung unter die totalitären Verhältnisse der SED-Diktatur, die sie durch ihre Unterwerfung noch stabilisierte, ja stärkte. Was man ihr nicht vorwerfen kann, ist diese totalitären, bolschewistischen Strukturen der SED-Diktatur geschaffen zu haben. Das haben Stalin und die SED getan. Doch die CDU-Ost hat auch bis heute ihr Versagen zu DDR-Zeiten nicht eingeräumt. Stattdessen pflegt sie das Bild von der Tugend des Überwinterns, was bei Lichte besehen, nichts anderes als der Versuch war, ein wenig an den Futtertrögen der Macht, die ihr die SED hinhielt zu naschen. Mehr war es ja nicht. Doch ihr eigentliches Versagen ist das ohnmächtige Hineinbegeben in die repressiven Strukturen der SED-Diktatur, ohne einen Gedanken an ihre Überwindung zu verschwenden. Sie hat sich vollständig selbst aufgegeben. Und bis heute tut sie so, als sei das der bestmögliche Weg zur Überwindung der SED-Diktatur gewesen. Wo ist da der Stolz einer bürgerlichen Klasse, die um ihre Stärke weiss, um ihre Tat- und Schaffenskraft, um ihre bildungsbürgerlichen und unternehmerischen Traditionen, um ihre Freiheitstraditionen, einer Klasse, die weiss, bzw. wissen müsste, dass absolutistische Strukturen dem Untergang geweiht sind, dass Vernunft der Freiheit bedarf, und dass daher alle Staaten untergehen werden, die ihren Bürgern diese Freiheiten nicht gewähren.
Heute tut die CDU so, als hätte sie ja nur auf den Untergang der SED gewartet. Doch wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie sich darauf vorbereitet, dann hätte sie den Untergang beschleunigt, dann hätte sie sich zu einem Partner Gorbatschows gemacht, dann wäre sie zu einem Hoffnungsträger in der DDR avanciert. Doch das war sie nicht, zu keinen Zeiten. Sie war ein Nutzniesser der Revolution von 1989, sie war nicht deren Vorbereiter. Sie hat einfach Glück gehabt. Und dieses Glück ist Gift für die Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte. Es geht da nicht einfach nur um die Stasi-Strukturen, die sich in der CDU-Ost fanden. Es geht um ihre Würdelosigkeit, mit der sie die DDR überwintert hat. Bis heute hat die CDU dafür keinen Namen gefunden. Sie müsste sich schämen für ihr Verhalten, und sie müsste Abbitte leisten. Statt dessen hat sie der ehemaligen SED den Schwarzen Peter für ihr Versagen in der DDR zugespielt. In ihren Augen war die SED an allem Schuld. Und solange dies die Räson der CDU ist, solange wissen wir, dass sich die CDU ihrer DDR-Geschichte bis heute nicht gestellt hat. Deshalb der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der ehemaligen kommunistischen Staatspartei, bemäntelt mit einem kongruenten Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber rechts, also der AfD, der bekanntlich, siehe Thüringen und die Wahl von Kemmerich, das Papier nicht wert war, auf dem er festgehalten wurde.
Trotzdem das bleibt festzuhalten. Nicht die CDU hat die SED.Diktatur und die DDR geschaffen, das waren die Kommunisten, das war Stalin und die SED. Aber die Würdelosigkeit, mit der die bürgerlichen Schichten in der CDU sich den totalitären Verhältnissen in der DDR unterworfen haben, ihre politische Konzeptions- und Ideenlosigkeit und ihre Selbstlegendierung als Tugend und als Überwinterungsstrategie, das bezeichnet das Versagen der CDU.
Man sieht also, auch in Sachen Aufarbeitung kann man die CDU und die LINKEn, die ja aus der ehemaligen SED hervorgegangen sind, nicht in einen Topf werfen. Zu unterschiedlich ist die Gemengelage, zu unterschiedlich ist das Versagen.
3.
Im Grunde waren beide, die DDR genauso wie Hitlerdeutschland, bzw. die NS-Diktatur totalitäre Staaten. In beiden Fällen herrschten nicht nur Staatsparteien, bzw eine kleine Clique an Funktionären, die in ihren Händen die gesamte staatliche Macht bündelten. Sie griffen in fundamentale Rechte ihrer Bürger rücksichtslos ein, wenn das in ihren Augen aus Machterhaltungsgründen oder aus einer Laune heraus geboten schien. Und keiner ihrer Bürger hatte die Möglichkeit, sich dagegen in irgendeiner Weise zu schützen. Genau diese Verhältnisse meint der Begriff „Unrechtsstaat“.
Dass es aus Machterhaltungsgründen auch für eine absolutistische Clique an Staatsführern geboten ist, Regeln zu erlassen, um das Funktionieren einer Gesellschaft zu ermöglichen, wie die Strassenverkehrsordnung, oder das Schulwesen usw. ändert am Unrechtscharakter des totalitären Staates nicht das Geringste.
Warum also diesen Begriff „Unrechtsstaat“ in Frage stellen? Dies nützt nur jenen Nostalgikern, die den Unrechtscharakter der DDR in Frage gestellt sehen möchten, und die aus diesem Grunde die Bereiche quasi unpolitischer Rechtsbereiche hervorheben, um damit die DDR insgesamt zu rehabilitieren.
Das ist keine Aufarbeitung. Das ist Verharmlosung, das ist Verklärung.
Was ist denn dabei? Wen trifft denn der Vorwurf, die DDR sei ein Unrechtsstaat gewesen? In der Regel diejenigen, die sich über ihren Unrechtscharakter nicht im Klaren waren, und die sich von diesem Vorwurf getroffen fühlen.
Nein, niemand braucht sich des Umstands zu schämen, dass er in einem Staat gelebt hat, der ein Unrechtsstaat war, und dass er ihn überstanden hat, und zum Schluss, dass er überwunden wurde, ja dass ihn Millionen von Menschen überwunden haben.
4.
Ist die LINKE eine normale Partei?
Schlicht und einfach: nein. Das ergibt sich aus ihrer Geschichte.
Dass ihre Mitglieder die Geschichte ihrer Partei nicht aufgearbeitet haben, hat mit ihrer Geschichte zu tun. Dass sie Mitglieder gewinnt, die an Aufarbeitungsfragen kein Interesse haben, hat etwas mit den erfolgreichen Diskreditierungskampagnen gegenüber der Aufarbeitung zu tun. Doch ein Beweis für den demokratischen Charakter der LINKEn ist das nicht.
Aufarbeitung ist das Benennen, was war. Die Mitschuld am kommunistischen Unrecht in Deutschland, kann man der LINKEn nicht erlassen. Ihre Teilhabe am kommunistischen Unrecht in der Welt auch nicht. Sie, die LINKE mag sich auf dem Boden der demokratischen Spielregeln tummeln wie ein Fisch im Wasser, ihre Zuverlässigkeit in Sachen Bewahrung der Demokratie und der Republik verbessert das nicht. Die ergibt sich nur aus einer glaubhaften Aufarbeitung des Versagens der Politik der kommunistischen Parteien in Deutschland seit 1918.
Man mag Koalitionen mit der LINKEn eingehen wollen, doch das bedeutet eben nicht, sie aus der Verantwortung für ihre Schuld an Millionen Menschen zu entlassen. Im Gegenteil, jede Koalition, jede Art der Partnerschaft mit der LINKEn muss sich auch am Verhältnis zu der Schuld der kommunistischen Partei in Deutschland orientieren.
5.
Irgendwie gehören diese drei Botschaften im Interview vom MDR zusammen. In der Tat lässt sich eine Klammer finden. Alle drei Botschaften bedienen das Blockdenken, das rechts-links-Schema, mit dem Koalitionen und Partnerschaften im vermeintlich linken politischen Spektrum legitimiert werden.
Man findet diese Betrachtungsweise in den Medien, in grossen Teilen der politisch interessierten Öffentlichkeit und natürlich in der LINKEn selbst, die ja ihren eigenen Namen von diesem Denken abgeleitet hat. Aber auch grossen Teilen der SPD ist dieses Denken eigen, bis hin zu den Grünen lässt es sich finden.
Produktiv ist dieses Denken nicht. Denn ist ein ideologischer Ansatz. Er fragt nicht zuerst danach, was die unterschiedlichen politischen Kräfte in der Sache selbst wollen, sondern wie sie sich selbst verstehen. Es geht nicht um den Wettstreit der Konzepte, der Erfahrungen und der Handlungsstrategien. Es geht um vermeintliche übergeordnete Gemeinsamkeiten an und für sich unterschiedlicher politischer Kräfte. Dahinter verblassen die Unterschiede dann.
Die SPD verliert bei diesem Herangehen ihr Alleinstellungsmerkmal als sozialdemokratischer Kraft. Genau in dieser Falle befinden sich die beiden z.Z.-Vorsitzenden, Esken und Borjan. Ihr Anliegen mit Hilfe einer rot-rot-grünen Koalition im Bund auch nach der nächsten Wahl an der Macht zu bleiben, und vielleicht auch den Kanzler zu stellen, wird mit dem Links-Rechts-Schema argumentativ bekräftigt. Faktisch aber machen sie die SPD damit auf lange Sicht überflüssig. Was sie stark gemacht hat, war ihr spezifischer sozialdemokratischer Politik-Ansatz. Genau der geht beim Links-Rechts-Schema verloren, dann sind nämlich zum Schluss alle nur noch links. Und, so fragt man sich, was hat alles Andienen dann gebracht?
 Stephan Hilsberg
Texte und Musik
Stephan Hilsberg
Texte und Musik

